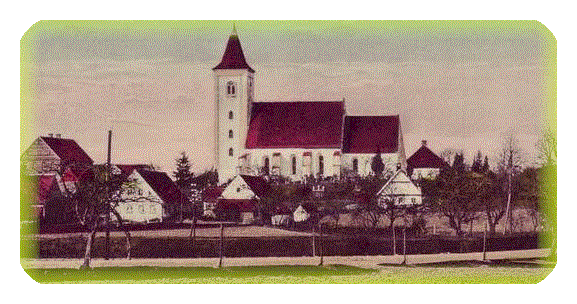
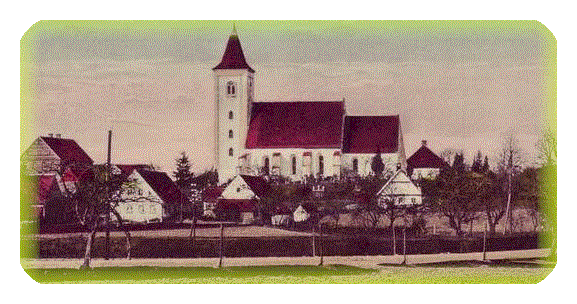
Aus Liebe zu meinem Vater
und damit er für die Familienmitglieder
am Leben bleibt
Rosemarie Christiane Erdmann
geb. Heinze
Benau, dass Heimatdorf meiner Vorfahren väterlicherseits, liegt lang gestreckt - im Kreis Sorau - im schönen Bauernland der Niederlausitz.
Es war einmal Deutsch, aber nach dem Ende des schrecklichen Zweiten Weltkrieges wurde es Polen zugesprochen. Aus Benau wurde Bienow und aus Sorau wurde Zari.
Alles was ich in meiner Geschichte erzähle, hat sich in der alten deutschen Zeit zugetragen und darum möchte ich gerne bei den alten Ortsnamen bleiben.
Sie werden auch in den Papieren, die beigefügt sind, verwendet.
Viele Heinzes lebten über Generationen arbeitsam und glücklich in diesem Dorf. Seit es polnisch ist, gibt es dort keine Heinzes mehr. Vielleicht ließen sich auf dem Friedhof noch einige alte Grabsteine entdecken. Ich will mit meiner kleinen Erzählung an etliche Heinze-Dörfler und an die Neumanns aus Grabig erinnern.
In der Nacht vom 16. zum 17. April 1903 fegte ein mächtiger Schneesturm über das Dorf Benau im Kreis Sorau hinweg und vergrub es fast unter den dicken Flocken. Es war, als wollte der Winter den Frühling nicht ins Land lassen, sondern noch einmal Weihnachten feiern.
Als der junge Schmiedemeister Ernst August Heinze am frühen Morgen erwachte, merkte er sofort, dass etwas nicht stimmte. Er lauschte in die Finsternis des Schlafzimmers und hörte seine beiden Kinder ruhig schlafend atmen. Vorsichtig stieg er aus dem Bett und lief zu einem der beiden Fenster, um hinauszusehen. Aber er sah nichts. Der Schnee hatte es bis obenhin zugeschüttet. Daher kam also diese eigenartige ungewöhnliche Stille. Dann aber hörte er das unterdrückte Stöhnen seiner jungen Frau Karoline. Es war also wieder soweit! Sie lag in den Wehen! Das dritte Kind wollte auf die Welt kommen. Ausgerechnet heute! Er musste sofort die Hebamme herbeischaffen! Er beruhigte seine Frau, zog in Windeseile seine Sachen an und wollte losrennen. Das war aber unmöglich, der Schnee versperrte die Haustür. Sie ließ sich nicht öffnen. Er lief die Treppe zum Dachgeschoß hoch, wo die Kammern der beiden Gesellen und der beiden Lehrlinge lagen, die im Haus in Kost und Logis wohnten. Er scheuchte sie von ihren Strohsäcken, die in den Bettgestellen als Matratzen dienten; erklärte die Lage und befahl ihnen, unter allen Umständen einen Zugang zum Haus frei zu buddeln.
Wieder im unteren Wohnbereich - fand er zum Glück ein Fenster, das weniger blockiert war. Er kletterte hinaus und robbte erst einmal zum Haus seiner Eltern, die ganz in der Nähe wohnten. Er alarmierte sie und bat um Hilfe. Es wurde dringend eine Frau - wie seine Mutter es war - gebraucht, die der Karoline Beistand geben konnte, bis er mit der Hebamme zurück war. Alles klappte und verlief wie am Schnürchen. Die jungen Männer buddelten wie die Teufel das Haus frei, so dass die Hebamme es ohne Schwierigkeiten betreten konnte. In großen Kesseln summte heißes Wasser. Es dauerte gar nicht mehr lange und der kleine August Paul Heinze war auf der Welt und lag frisch gebadet und gewickelt im Wäschekorb. Nun hatten Ernst August und Karoline also drei Kinder. 1900 war die erste Tochter geboren und Anna genannt. 1902 folgte ein Sohn Oskar und nun 1903 hatte sich der kleine Paul dazugesellt.
Ernst August konnte seine Familie gut ernähren. Er war ein tüchtiger und geschickter Schmiedemeister. Sein Geschäft lief prächtig. Er baute Wagen, große und kleine Schlitten, Pflüge und beschlug auch Pferde. Einen Huf neu mit Eisen zu beschlagen, kostete 50 Pfennige. Er war in Benau ein viel beschäftigter Mann. Als er seine Meisterprüfung bestanden hatte, zweigten seine Eltern von ihrem Grund und Boden in Benau einen Morgen Land ab und bauten für ihn in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ein Wohnhaus darauf und eine große Schmiedewerkstatt. Der Vater von Ernst August war der am 23.08.1842 in Benau geborene Gottlieb Ernst Heinze. Die Mutter eine Johanne Auguste Rattke, am 21.03.1843 auch in Benau geboren. Ich werde sie in meiner Erzählung immer Gottlieb und Auguste nennen, weil mir ansonsten alle Namen durcheinander kommen.
Das Wohnhaus, das Gottlieb und Auguste für ihren Sohn Ernst August gebaut hatten, war ein schönes Haus in einem ausgedehnten bunten Bauerngarten. Primeln säumten die Beete; es gab einen Riesenrosenstrauch, der süß duftete und alle Arten von Blumen, die man sich nur denken kann; Obstbäume, Beerensträucher und eine große Gemüseabteilung. Das Haus war an der Sonnenseite von Wein umrankt, der im Herbst gelbe Trauben trug.
Der Clan der Heinzes lebte schon lange in Benau; schon über Generationen. Die Großeltern vom kleinen Paul - Gottlieb und Auguste - nannten einen kleinen, aber äußerst hübschen Bauernhof im Mitteldorf ihr Eigen.
Durch ihre Tüchtigkeit und ihren Erfolg waren Gottlieb und Auguste sehr geachtete Leute unter den Dörflern. Was sie anfingen, gelang ihnen. Ihr kleiner hübscher Bauernhof besaß eine bestaunte Wunderlichkeit. Knecht und Magd hatten unterm Dach je eine eigene Kammer, die einfach, aber gemütlich eingerichtet war. An den kleinen Fenstern hingen sogar weiße Mullgardinen. Besonders die Gardinen an den Gesindekammern waren eine Sensation für ganz Benau. Ja, die alte Auguste Heinze hatte so etwas wie Kultur im Blut. Auf anderen Höfen war es üblich, Knechte und Mägde in wahren Verschlägen primitiv hausen zu lassen. Gottlieb und Auguste erwiesen sich in dörflichen Sinne als sehr geschäftstüchtig. Gottlieb war nicht nur Bauer, sondern auch ein geschätzter Schulvorstand. Nebenbei betrieb er eine kleine Imkerei, die etwas Geld in seine Kasse klingeln ließ. Er hatte über 20 Bienenvölker, die er im Sommer auf die Wiesen karrte. Im Vorratsraum des Hauses standen zum Erstaunen der Kinder riesige Töpfe voller goldfarbenen Honigs. Paul erinnerte sich noch im Alter an die schmerzhaften Stiche, die ihm die Bienen zufügten, wenn er seinen Opa auf die Wiesen begleitete. Der Opa trug bei seinem Kontrollgang immer ein schmauchendes Pfeifchen und einen Hut mit Schleier.
Ganz nebenbei erzählte der Opa Gottlieb dem kleinen Paul von dem Leben der Bienenvölker.
Aber der kleine Paul wollte nicht glauben, dass die Bienen riechen können, wenn er Angst vor ihnen hat und ihn dann ganz besonders gerne stechen. Paul lachte dann und schrie: "Nee, nee das stimmt nicht!“ Und der Opa brummte: "Lach du mal nur! Dat hat schon seine Richtigkeit, Männel!“
Gottlieb Heinze besaß einen eigenen großen Webstuhl und seine Frau Auguste auch. In ihrem Haus hatten sie sich extra einen Raum für ihre Weberei eingerichtet. Während wir heutzutage fast alle abends vor dem Fernseher hocken, ließen sie damals ihre Schiffchen flitzen. Sie webten hauptsächlich Tisch- und Bettwäsche und allerfeinstes Linnen für die Hemden der Offiziere. Dieses brachte ihnen das meiste Geld ein, war aber sehr zeitraubend herzustellen.
Den Flachs, auch Echter Lein genannt, den die alten Heinzes für ihre Weberei brauchten, bauten sie auf ihren eigenen Feldern an. Flachs ist eine ungefähr 70 cm hohe strauchartige Pflanze. Es sieht wunderschön aus, wenn ganze Felder in himmelblauer Blüte stehen. Ist die Blütezeit vorbei und die Leinsamen reif, werden sie von Hand mit der Wurzel ausgerissen. Über einem Brett schlägt man den Samen in Wannen aus und stellt das Kraut zu Hocken auf, damit es trocknen kann. Etwas später dörrte man sie im großen Backofen weiter. Danach brach und klopfte man sie so lange, bis alle Fasern glatt und sauber waren. Nun konnte man sie für den Winter zum Verspinnen aufbewahren. Den Leinsamen transportierte man zur Ölmühle. Um das Ölaroma zu verbessern, wurde es hier vor dem Auspressen geröstet und man gewann das beliebte hochgeschätzte Leinöl. Durch eine andere Art der Ölgewinnung erhält man Rohöl für Fensterkitt und zur Linoleumherstellung. Weil dieses Öl die Eigenschaft hat, zu trocknen, benutzen es Kunstmaler für ihre so genannten Ölgemälde. Mit Farbpigmenten verrührt trocknet es auf der Leinwand und überdauert so Jahrhunderte. Aber unübertroffen ist das Speise-Leinöl aus einer guten Ölmühle zu Pellkartoffeln und Quark.
Wenn Gottlieb und Auguste farbiges Garn für Muster in ihren Tischdecken oder Geschirrtüchern brauchten, färbten sie es nicht selber, sondern bestellten es in einer handwerklichen Färberei und es wurde angeliefert. Bettlaken wurden praktisch endlos zu vielen Metern gewebt und dann auf großen Rollen verkauft. Aber ihre Spezialität war das feine Linnen für Offiziershemden.
Alles was Gottlieb und Auguste Heinze an Geld sparen konnten, investierten sie in eine gute Ausbildung ihrer Kinder und in den Start einer Geschäftsgründung ihres Nachwuchses. Sicherlich wird sie das manchen persönlichen Verzicht gekostet haben, denn sie waren ja keine reichen Leute. Aber ihr Nachwuchs war es ihnen wert.
Aus ihrem Sohn Ernst August, geb. am 1.7.1872, war - wie schon beschrieben - ein tüchtiger Schmiedemeister mit eigener Werkstatt geworden. Ein anderer ihrer Söhne besaß in Benau ein gut gehendes Kolonialwarengeschäft und eine Kaffeerösterei. Aber die Krönung ihres Lebens wird für Gottlieb und auch für Auguste, ihr am 9.10.1874 geborener Sohn, Friedrich Ernst Gustav gewesen sein.
Man war sich erst unschlüssig gewesen, über den Beruf den der Gustav erlernen sollte. Da Gottlieb im Benau Schulvorstand war, pflegte er einem engen Umgang mit den Benauern, die im Dorf das Sagen hatten. Er stand so auch dem damaligen Pfarrer recht nahe und beriet sich mit ihm. Der Pfarrer redete Gottlieb zu, den Gustav Orgelbauer werden zu lassen - und Gottlieb nahm den Rat an.
Gustav kam in die Lehre zum Orgelbaumeister Uebe in Neuzelle. Nach erfolgreichem Abschluss arbeitete er als Geselle bei verschiedenen Orgelbaumeistern, um Erfahrungen zu sammeln. So auch bei Wilhelm Sauer, der königlicher Hofbaumeister war. So gelang es Gustav, an der Orgel der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin mitzubauen. Leider wurde sie im Zweiten Weltkrieg zerstört.
1904 - als Gustav selbst Orgelbaumeister war - gründete er in Sorau, in der Auenstraße 36, seinen eigenen Betrieb. Das Glück war ihm hold - er wurde ein sehr bekannter und viel beschäftigter Mann. Gustav baute in der Zeit von 1904 bis zum Zweiten Weltkrieg an die 230 neue Orgeln; oder sogar mehr. Vorwiegend in Schlesien, der Niederlausitz und Brandenburg. Darunter waren große Instrumente wie die in Forst und in Cottbus. Ich glaube, von den großen hat nur die eine in Sorau, in der Garnisonkirche, standgehalten. Viele wurden ein Opfer des Krieges, aber andere haben überlebt und zeugen heute noch von Gustavs kunstvollen Schöpfungen.
Auf einer Orgel von ihm, in Müllrose, werden oft Konzerte veranstaltet. Seine größte Orgel, die die Jahre in Berlin und Brandenburg überlebt hat, steht in der Friedenskirche in Berlin-Niederschönhausen. Sie besticht durch ihre zeitlose, schlichte vornehme Eleganz. Es gibt in Lindenberg einer Orgel von Gustav, die noch im Originalzustand von 1928 sein soll. Gustav gründete mit seinen drei Söhnen Günther, Reinhold und Lothar noch Filialen in Kolberg und in Stadtilm in Thüringen. Alle drei Söhne waren dem Vorbild des Vaters gefolgt und hatten wie er, es zu dem Beruf des Orgelbaumeisters gebracht. Gustav war mächtig stolz auf seine Söhne. Sie unterstützten ihn tüchtig und Gustav konnte in Ruhe altern. Aber dann verließ ihn das Glück. Ich werde jetzt vorweg greifen, denn so ausführlich komme ich nicht wieder auf Gustav zurück. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Orgelbauanstalt in Sorau geschlossen. Eine andere Firma, die kriegswichtig war, zog ein. Am 8.3.1945 verstarb seine Ehefrau, die am 15.10. 1881 geborene Hedwig Kaiser. Drei Polinnen erschlugen sie vor den Augen der damals sechzehnjährigen Enkeltochter Sigrid. Als die drei Polinnen, Mörderinnen darf man sie wohl nennen, von der alten, am Boden liegenden Frau abließen, lebte sie nur noch ein paar Stunden und verstarb im Beisein ihrer fassungslosen entsetzten Familie. Dann vertrieb man sie alle aus dem Haus, aus der Werkstatt, vom Grundstück - aus der Heimat. Man erzählt in der Familie, dass Gustav sich erschießen wollte. Wer könnte es ihm verdenken? Aber er tat es nicht. Er floh nach Thüringen und verstarb am 23.1. 1949 in Rudolstadt.
Damals, in der Zeit, in der meine Erzählung sich abspielte, waren alle Benauer schon mächtig stolz auf Gustav und besonders darauf, dass einer von ihnen es geschafft hatte, sich ein besseres Leben aufzubauen. Gustav hatte schon lange vor dem 1. Weltkrieg ein großes schnittiges Auto. Und wenn er nach Benau kam, um seine Eltern zu besuchen, lief die gesamte Dorfjugend zusammen, um das Vehikel zu bewundern. Und so mancher Bauer musste plötzlich mal eben etwas besorgen und auf dem Weg dorthin an der Wunderkarosse vorbeigehen. Gustav hatte schon damals über 30 Angestellte. Einmal hatte er so eine große Orgel zu bauen, dass das Dach der Werkstatt abgerissen und höher gebaut werden musste. Gustav war jedenfalls damals der Held von Benau. Ich bin auch eine seiner Bewunderin und heute noch stolz auf ihn.
Ich will meine Erzählung zu den jungen Schmiedemeistern zurückführen, damit ich den Einstieg in Karolines Familie, aus der sie stammte, besser finde.
Ernst August Heinze war am 1.7.1872 in Benau geboren. Ernestine, Karoline in Grabig am 5.9.1881. Grabig gehört auch zum Kreis Sorau und liegt etwa 12 km von Benau entfernt. Ernst August lernte Karoline auf einer Kirmes in Grabig kennen und verliebte sich auf der Stelle in die 16jährige. Karoline lernte Schneiderin. Ehe sie ihre Lehre antreten konnte, war sie Küchenmädchen auf dem großen Gut bei Grabig. Die beiden Verliebten heirateten am 23. Mai 1899. Ernst August wurde gerade 27 Jahre alt und Karoline war noch keine 18 Jahre. Der Bräutigam brachte das Grundstück mit Wohnhaus und Schmiede mit in die Ehe - Karoline den Hausstand und Bargeld.
Die Hochzeit wurde drei Tage lang in Grabig gefeiert. Da Karolines Vater, der Schafmeister Ernst Neumann, ein im weiten Umkreis bekannter Tier- und Wunderheiler war, wurde es eine verhältnismäßig große Hochzeit. Von überall kamen Gäste, um zu gratulieren. Über der Hauptstraße in Grabig war ein mächtiger Triumphbogen errichtet worden, durch den die Kutsche mit dem Brautpaar fahren musste als sie aus der Kirche kamen. Die Hochzeit war ein guter viel versprechender Start für die glücklichen jungen Eheleute.
Die Frau des Schafmeisters Ernst Neumann, die Mutter seiner Kinder, war eine Ernestine Jachmann aus Billendorf. Sie hatten, wie es so oft in alten Märchenbüchern zu lesen steht, drei schöne Töchter und zwei Söhne. Da war die älteste Tochter Karoline, die gerade nach Benau geheiratet hatte. Nach ihr war der Sohn Paul geboren, dann Emilie. Emilie gebar 1902, als sie gerade 17 Jahre alt war, einen unehelichen Sohn vom Gutsinspektor. Sie taufte ihren kleinen Sohn Willi und blieb ihr ganzes Leben lang ledig. An Freiern wird es nie gefehlt haben, denn sie war eine sehr gut aussehende Frau. Sie zog es aber vor, unverheiratet zu sein. Sie blieb bei den Eltern und später bei Paul und dessen Frau Frieda. Dann war da die Tochter Anna, die einen Otto Schmidt aus Pitschkau heiratete. Von ihr weiß ich leider nichts. 1889 gebar Ernestine ihr letztes Kind, den Sohn Reinhold. Es war eine sehr schwierige Geburt. Das Kind war groß und kräftig und brauchte eine zu lange Zeit, um endlich auf die Welt zu kommen. Durch Sauerstoffmangel hatte es Schaden erlitten, so dass ein Schleier über seinem Leben lag, und Reinhold es ohne Hilfe nicht meistern konnte. Reinhold blieb geistig behindert, so lange er lebte.
Mir hatte niemand von ihm erzählt, dabei muss mein Vater ihn gut gekannt haben.
Schämte man sich seiner? Erst neulich, vor Ostern 2006 hörte ich erstmals von ihm, als ich bei Willis Tochter Lotti war, um sie nach alten Familienereignissen auszufragen.
Um der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit wegen, will ich Reinhold nicht verschweigen, denn er war ja einer von uns und er hat Freude und Schmerz empfunden, hat gelacht und geweint, seine einfachen Arbeiten verrichtet und auch seine Träume gehabt wie du und ich. Ich will nicht, dass er vergessen wird. Er gehört zu uns!
Wenn ich sein Sterbedatum (1933) betrachte, werde ich sehr nachdenklich. Mich überkommt ein schlimmer Verdacht und ich vermute ein grausiges Verbrechen.
Alle diese Kinder waren in der Schäferei geboren, in der schon über 100 Jahre die Neumanns das Amt des Schafmeisters innehatten. Diese Schäferei war ein im freien Landschaftsgelände liegender Gebäudekomplex, der zu einem großen Gut bei Grabig gehörte. Ernst Neumann konnte dort selbständig wirtschaften, musste Knechte und Hirten aus eigener Tasche bezahlen. Ein Knecht verdiente bei ihm im Jahr 80 Taler bei freier Unterkunft, Essen und Trinken. Sein eigener Lohn bestand zum Teil aus Geld und zum anderen Teil aus einem Deputat, zu dem auch Schafe gehörten. Dadurch besaß er selbst eine eigene Schafherde, die er gleich mit hütete. Zum Gut gehörten etwa 1000 Tiere, und sein eigener Viehbestand umfasste 200 Schafe.
Ernst war ein großer, hagerer Mann mit tiefem Respekt vor jedem Lebewesen - sei es ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze. Er kannte jedes Schaf seiner großen Herde. Er erlebte ihre Geburt und ihren Tod. Er pflegte sie, wenn sie erkrankten und half ihnen ihre Lämmer in die Welt zu setzen. Wenn er mit seiner Herde und den Hirtenhunden langsam über die Landschaft zog oder irgendwo verweilte, strickte er. Den Faden spann er sich auf der Wiese selbst von der ausgekämmten oder ausgezupften Wolle seiner Tiere. Mit der flachen Hand zwirbelte er sie auf seinem Knie zu einem Faden, den er dann auf einen Stock wickelte. Meistens fertigte er Strümpfe für die ganze Familie an. Gewaschen und gebleicht wurden sie erst, wenn sie fertig waren.
Durch die enge Verbundenheit mit den Tieren und der Natur, verstand er sehr viel vom Leben, vom Sterben und von Krankheiten. Schon seit über 100 Jahren übte immer ein männliches Mitglied seiner Familie den Beruf eines Tier- und Wunderheilers, Hellseher und Besprechers aus. Er war seinen Vorfahren mühelos gefolgt. Es lag ihm im Blut. Er war ein in der ganzen Umgebung gesuchter Heiler für Tiere und für Menschen. Von überall her schickten die Bauern nach ihm, wenn ein Tier erkrankt war oder nicht kalben konnte. Hauptsächlich bei Rindern hatte er erstaunliche Heilerfolge. Bauern und Bäuerinnen kamen mit ihren Gebrechen. Hatte eine Frau eine kranke Brust, behandelte er sie mit der gleichen Salbe, die er auch auf einen Kuheuter schmierte. So behandelte er auch später seine Enkeltochter Anna, die als junge Frau an einer sehr schlimmen Brust litt und in Berlin in der Charité operiert werden sollte. Opa Ernst sagte aber zu ihr: „Das mache ich selber!“ Er schmierte ihre Brust dick mit einer dunklen schrecklich stinkenden Paste ein. Jeden Tag - eine Woche lang - die Brust war geheilt und Anna brauchte nicht operiert werden. Anna erzählte später, Opa Ernst habe gesagt, in der Paste sei Aschenöl und Bilsenkraut gewesen. Die anderen Beigaben hatte sie vergessen. Ernst ging auch Tiere und Menschen besprechen. So heilte er Gürtelrosen, Ausschläge und Warzen. Von Zeit zu Zeit konnte er Hellsehen, sagte man. Diese Gabe vererbte er auf seinen ältesten Sohn Paul.
Der Tierarzt war dem Schäfer Ernst freundschaftlich verbunden und holte sich bei ihm manchen guten Rat, verschiedene Salben, Mixturen oder Tees. Ernst kannte jede Pflanze, jedes Blatt und stellte alle seine Heilmittel selbst her.
Irgendwann gab das Gut die große außerhalb gelegene Schäferei auf und richtete eine neue in Grabig ein. Als mehr und mehr Baumwolle auf den Markt drängte, lohnte sich das Geschäft mit der Schafzucht nicht mehr und das Gut gab die Schäferei ganz auf. Ernst und Ernestine kauften sich einen kleinen Bauernhof in Grabig. Von Ernestine ist wenig übermittelt worden. Eigentlich nur die Erinnerung an eine kleine gebückte Frau, die eine äußerst liebevolle Großmutter für alle Enkelkinder war und von Herzen wieder geliebt wurde. Der kleine Bauernhof in Grabig war etwa 23 Morgen groß. Ernst schaffte sich 5 Kühe, 2 Pferde, 6 Schweine, eine Gänseschar, zahlreiche Kaninchen, Enten und Hühner an. Er konnte gut wirtschaften und der Hof ernährte sie. Auf der Wetterfahne des Hausdaches stand „1890“.
Wenn sich der Herbst ankündigte, lauerten Karolines drei Kinder, Anna, Oskar und der kleine Paul schon auf den Tag, an dem sie verkündete: „Heute machen wir Sauerkraut ein!“ Dann jubelten die Kinder, denn sie wussten, es würde ein großer Spaß werden.
Das große Holzfass stand schon sauber bereit und wurde nur noch einmal mit Essig ausgerieben. Die zwei Lehrlinge aus der Werkstatt ließen es sich gerne gefallen, zum Kohlschneiden abkommandiert zu werden. Es war damals üblich, dass Lehrlinge auch in Haus und Hof aushelfen mussten. Ein Riesenhaufen Kohlköpfe lag bereit, um in feine Streifen geschnitten zu werden, die dann mit etwas Salz ins Fass geschichtet wurden. Dann schlug die Stunde der Kinder. Zuerst steckte Karoline sie mit den nackten Beinen in eine Schüssel voll warmem Wasser und schrubbte mit einer Wurzelbürste Beine und Füße, bis sie blitzsauber waren. Und dann wurde das erste Kind barfüssig aufs eingeschichtete Kraut ins Fass gestellt. Es durfte vor Vergnügen kreischend darauf herumstampfen und trampeln. Wurde das erste Kind langsam müde, kam das zweite Kind an die Reihe, dass die Ausgelassenheit schon gar nicht erwarten konnte. Zwischendurch wurde immer wieder geschnittener Kohl zugeschichtet; ein wenig Salz und ein paar Wacholderbeeren zugegeben.
Während
einer Pause und keiner auf Paulchen achtete, wollte der kleine Lümmel mal
nachsehen, wie es wohl in dem Fass drinnen aussieht. Er durfte ja noch nicht
stampfen. Überall raufzuklettern war seine Spezialität. Meistens fiel er dabei
auf die Nase und brüllte wie am Spieß. Als er das Fass erklommen hatte, rutschte
er hinein, schrie wie am Spieß und strampelte vor Angst wie ein Verrückter.
Natürlich hob man ihn sofort lachend heraus und amüsierte sich darüber wie er
aussah. Er war überall mit Kohl behangen wie mit Lametta. Sofort hatte er seinen
Spitznamen weg. Für einige Zeit nannten ihn alle das Krautmännel.
Das hörte Paul
gar nicht gerne und wenn ihn Anna oder Oskar so riefen, plärrte er gleich los,
haute und boxte um sich. Das Sauerkraut wurde so lange gestampft, bis sich so
viel Saft gebildet hatte, dass er über dem Kohl stand. Dann verkündete Karoline:
„Kinder es ist genug!“ Sie legte Weinblätter obendrauf, dann die zugeschnittene
Schieferplatte in der passenden Größe - und auf die wiederum einen ganz sauber
geschrubbten schweren Feldstein. Dieser drückte die Schieferplatte so weit
herunter, dass sie vom Saft des Krautes umspült war und den Kohl darunter
festhielt. Nun wurde es in eine Ecke gestellt und die Milchsäure konnte sich in
Ruhe bilden. Andächtig und stolz beobachteten die Kinder, wie Karoline noch
einen Deckel auf das Fass legte.
Sonntags putzte Karoline die Kinder hübsch heraus - Ernst August zog seinen Sonntagsanzug an und putzte sich mit der Taschenuhr an goldener Kette - setzte seinen feschen Hut unternehmungslustig auf - und dann durften ihn die Kinder begleiten. Entweder gingen sie zu einem Schlachtefest zu benachbarten Bauern oder Rechnungen kassieren.
Ernst August war ein liebevoller geduldiger Vater. Paul erinnerte sich sein Leben lang daran, wie sein Vater ewig auf allen Vieren, mit ihm auf dem Rücken durch das Wohnzimmer kroch und wie er selber Hü schrie oder Brr machte, und der Vater parierte wie ein gut geschultes Pferd.
Wenn die
Sonne so richtig vom Himmel lachte, durften sie der Oma Auguste vom Heinze-Hof
helfen. Die Oma legte ihnen immer sorgfältig ans Herz, sehr gewissenhaft zu
arbeiten, denn das sei eine besondere verantwortungsvolle Aufgabe. Oma Auguste
sagte immer, das was man gerade macht, muss man richtig machen, sonst taugt es
nichts. Die Kinder fühlten sich immer sehr geehrt, schon so groß zu sein, dass
sie für die Oma eine so wichtige Arbeit erledigen durften. Sie gingen zu ihr
rüber auf den Heinze-Hof und auf die große Wiese hinterm Haus. Da lagen die
fertig gewebten Tücher, groß und klein auf dem grünen Gras weit ausgebreitet, um
in der Sonne zu bleichen.
Darum nannte man die Wiese auch die Bleiche. Auguste verteilte Gießkannen. Die
Aufgabe der Kinder war es, die gewebten Tücher mit klarem Wasser zu begießen.
Und wenn diese in der heißen Sonne getrocknet waren, mussten sie den
Vorgang fortwährend wiederholen. So lange - bis sich der leicht gelbliche
Farbton des Flachses in ein leuchtendes Weiß verwandelt hatte.
Es war fast bei Todesstrafe verboten, die Webstücke zu betreten. Sie mussten blütenrein bleiben, sonst hätte Oma Auguste einen kleinen Tobsuchtsanfall erlitten. Wehe wenn ein Vogel, der über die Bleiche flog, einen Klecks fallen ließ. Die sonst so liebe Oma drohte mit der Faust gen Himmel und stieß wilde Flüche aus, so dass die Kinder sich vor Lachen im Grase kugelten. Neben dem Begießen der Wäschestücke übten die Kinder auch die Aufgabe von Hirtenhunden aus; sie bewachten die Bleiche nämlich vor den Hühnern. Sowie sie eines entdeckten, verjagten sie es auf der Stelle mit lautem Geschrei. Krähend, schreiend und flatternd stob das gehasste Federvieh auseinander. Oma sagte immer: „Kinder! Bloß keine Hühnerkacke, die ist das Schlimmste!“ Abends bekam jedes Kind ein 10 Pfennigstück und kam sich reich vor wie ein König.
Aber ach, der kleine Paul war ein erbärmlicher kleiner Wicht. Bis zu seinem vierten Lebensjahr wollte und wollte er nicht gedeihen. Er hatte schon vier Lungenentzündungen hinter sich. Einmal sogar mit einem gefährlichen Blutsturz. Opa Ernst aus Grabig hatte alle Hände voll zu tun, um ihn überhaupt am Leben zu erhalten. Als er eines Tages mal wieder zu Besuch kam, untersuchte er das Paulchen gründlich. Er befühlte und drückte ihn hier und da und roch sogar an seiner Haut und an seinem Atem. Dann verkündete er: „Ich glaube, der Kerl hat Würmer!“ Am nächsten Tag kam er wieder und brachte ein Fläschchen mit einer Flüssigkeit mit, die Paulchen austrinken sollte. Aber Paulchen weigerte sich hartnäckig, weil die Brühe so stank und scheußlich schmeckte. Dann endlich unter Androhung von lebenslangem Griespuddingentzug, willigte er schließlich ein und schluckte das schreckliche Gesöff.
Danach setzte Karoline auf Opas Anraten den kleinen Paul aufs Töpfchen. Nicht lange und Paulchen bekam schreckliche Bauchschmerzen; die Tränen kullerten über sein Gesichtchen. Aber dann! Dann kam der große Durchbruch! Aus Paul kamen so viele Würmer heraus, dass der Nachttopf halb voll war. Von Stunde an war Paul geheilt und entwickelte sich prächtig.
Bis zum fünften Lebensjahr trug Paul Röcke. Das war damals so und für ihn einesteils sogar praktisch. Anna, die die Älteste war - sie war drei Jahre älter - sollte immer auf ihn aufpassen. Sie hasste es wie die Pest und so ließ sie öfter ihren Frust an ihrem Bruder aus. Sie haute ihn, wenn er nicht so wollte wie sie, mit der Rute an die nackten Beinchen. Paul aber, nicht doof, hockte sich sofort hin und Anna traf nur den Rock, unter dem seine Beinchen vor der Rute sicher steckten.
An einem Wintertag erlitt Paulchen einen sehr schmerzhaften Unfall. Karoline kam aus Sorau und hatte für jedes Kind eine Apfelsine mitgebracht. Das war so eine Kostbarkeit für Paulchen, dass er jubelnd von dem Sofa sprang, auf dem er gerade gesessen hatte. Aber er sprang so ungeschickt, dass er sich beide Hüftgelenke auskugelte und schreiend liegen blieb. Die Heilung dauerte sehr lange. Zwischen zwei Stuhlreihen musste er erst wieder laufen lernen.
1905 musste Ernst August wieder eilig zur Hebamme Sommer laufen. Caroline lag mit dem 4. Kind in den Wehen. Die Kinder nannten die Hebamme immer Sommers Tante. Die Hebamme setzte alle drei Kinder auf das Haustreppchen. Sie sollten sich nicht wegrühren und mussten aufpassen, wann der Storch über Benau kreist und das Kind in den Schornstein werfen will. Dann sollten sie laut rufen. Aber so intensiv die Kinder auch den Himmel beobachteten, sie schienen ihn doch verpasst zu haben. Denn plötzlich gab es eine große Aufregung, das Kind - eine kleine Schwester - war schon da. Anna, Oskar und Paul bekamen Zuckertüten wie Schultüten mit Süßigkeiten geschenkt. Die Hebamme Sommer hatte immer wunderschöne schneeweiße Schürzen um, die die Kinder sehr bewunderten. Sie stellte sich oft vor den großen Kamin im Hausflur und machte ihnen vor, wie sie selber durch den Kamin gefallen waren. Sie sagte:“ Hier seid ihr rabenschwarz in meine weiße Schürze gepurzelt, und ich habe euch aufgefangen!“ Immer wieder wollten die Kinder das hören.
Dann durften sie zur Mutter und zur kleinen Schwester in das Schlafzimmer. Anna wollte unbedingt wissen, warum die Mutter im Bett liegt. Frau Sommer sagte: „Der Storch habe der Mutter beträchtlich ins Bein gebissen.“ Anna ließ keine Ruhe, die Mutter musste das Bein aus dem Bett strecken. Anna untersuchte es genau, konnte aber keinen blauen Fleck entdecken. Das kleine neue Geschwisterchen lag im Wäschekorb vor dem Ofen. Davor stand als Absperrung der Brotschieber, damit die Kinder das Baby nicht anfassen konnten. Anna wollte das Kind nicht. Sie meinte: „Sie wären schon genug - und so flüsterte sie der Mutter zu: „Wollen wir sie nicht aus dem Fenster schmeißen?“ Aber nein, sie konnte die Mutter nicht dazu überreden. Daraufhin wollte Anna, dass das neue Kind Bethlis heißt. Auch den Wunsch erfüllten die Eltern nicht - das kleine Mädchen wurde auf den Namen Marta Heinze getauft.
Von ihrem Onkel Gustav Heinze, dem Bruder ihres Vaters, der Orgeln in Sorau baute, bekamen die Kinder die erste Schokolade ihres Lebens geschenkt. Von den Eltern gab es keine, denn sie war viel zu teuer. Zuerst betrachteten die Kinder die Schokolade recht misstrauisch. Anna, die immer ein vorwitziges Mundwerk hatte, behauptete, die Schokolade sehe aus wie getrocknete Kacke. Aber die erste abgeknabberte Probeecke überzeugte sie, dass das braune Zeug köstlich war.
Immer ging der Spaß, den sich die Kinder machten, nicht so gut aus. Einmal gab es ordentlich Senge. Da hatten Paul und Marta beim Onkel Paul Heinze Eier aus den Nestern geklaut und damit es keiner merkt, Blecheier hineingelegt. In ihrer Spielecke buddelten sie ein Loch, schlugen die Eier hinein, rührten um und spielten, es sei Scheckelquark. Was das ist, weiß ich leider nicht. Vielleicht wussten sie es selber nicht.
In jedem Jahr im Frühling, wenn der Saft in den Baumstämmen stieg, machten Ernst August und Karoline ihren Kindern eine große Freude. Der Vater spannte das Pferd vor den Wagen und setzte seine Familie hinein. Karoline hatte schon vorher Wolldecken, einen großen Kuchen und Flaschen mit Trinkwasser, in dem eine Spur von Himbeersaft war, eingeladen. Und dann ging es los in die frisch grünenden Wälder. Anna band jedes Mal einen kleinen Strauß Gänseblümchen an die Peitsche. Und wenn der Vater dann mal übermütig mit ihr knallte, löste sich das Sträußchen und es regnete Gänseblümchen. Hei! Wie da alle lachten! Man kutschierte in einen Birkenwald, um Birkensaft zu ernten. Auf einer Lichtung breiteten sie die Decke aus und errichteten sich ein Lager. Aber dann ging es erstmal an die Arbeit. Ernst August schnitt die Rinde der Birken v-förmig ein und die Kinder banden winzige Näpfchen unter die tiefsten Stellen der Einschnitte. Dann hieß es warten bis der Saft austrat und in die kleinen Töpfchen floss. In der Wartezeit holte die Mutter den Kuchen und noch Schmalzbrote hervor und alle stärkten sich. Das ganze Jahr über schmeckte es ihnen nie so gut wie an diesem ersten Frühlingsausflug zur Waldwiese. Die Eltern lagen dann glücklich auf der Decke und genossen das Faulsein, während die Kinder spielten und herumbalgten. Nach etlichen Stunden waren die Näpfchen gefüllt und die Eltern gossen den kostbaren Saft in eine Glasflasche. Die Einschnitte in den Baumstämmen verklebten und verschlossen sich von selbst. Das grasende Pferdchen wurde wieder eingespannt und fröhlich fuhr man nach Benau zurück.
Einen Teil des Birkensaftes verwendete Ernst August als Haarpflegemittel, den Rest bekam Opa Ernst aus Grabig. Der Opa schätzte die terpentinhaltige Flüssigkeit sehr und brauchte diese für seine Einreibungen.
Leise schleichend trat eine Veränderung in das Leben von Ernst August und Karoline. Auch die Kinder spürten, dass etwas nicht mehr stimmte. Immer öfter schickte der Vater den kleinen Paul zum Händler Gustav Lehmann, um Sprit zu holen. Eine Seltersflasche voll kostete 20 Pfennige. Paul kostete auf dem Heinweg immer. Aber nur ein Tröpfchen, damit der Vater nichts merkte. Dann wurde der Vater krank, aber noch lief alles weiter wie gewohnt. Man feierte die Feste wie sie fielen und im Sommer badete die Benauer Jugend im Dorfteich. Eigentlich war das eine große Schweinerei, denn dieser war mehr mit Jauche gefüllt als mit Wasser. Die großen Jungen trieben ein irrsinniges Spiel. Mit einem Strohhalm bliesen sie Frösche auf, bis sie platzten. Die kleinen Jungen und die Mädchen entsetzten sich und rannten kreischend fort.
Die großen Feste waren Paul in guter Erinnerung geblieben. An Geburtstagsfeiern konnte er sich dagegen nicht erinnern. Diese Tage schienen keine große Bedeutung gehabt zu haben. Im Sommer, wenn überall Kirmes gefeiert wurde, das war schon eindrucksvoller. Da gab es Musik, ein Karussell und alle tranken reichlich Bier und es wurde getanzt, dass die Röcke der Frauen flogen. Und eine Schießbude gab es und einen „Haut den Lukas“. Da war was los und alle waren vor Freude und Bier ganz aufgeregt. Zur Begeisterung der Jungen kam es auch jedes Mal zu einer echten Keilerei mit wirklich blauen Augen - den so genannten „Veilchen“. Das war was!
Fastnacht gefiel auch allen. Wenn Fastnacht war, wurde auf dem Hof von Gottlieb und Auguste Heinze wirklich und wahrhaftig ein großer Waschkorb voll Pfannkuchen gebacken. Es war immer so viel, dass der Rest anfing zu schimmeln, aber Paul und seine Geschwister aßen sie trotzdem. Die Erwachsenen setzten sich bunte Hüte auf und gingen ins Wirtshaus feiern. Sie sagten dann, sie gehen zum Ball. Es gab auch immer einen kleinen Festzug mit Kostümierung, dessen Sinn Paul aber nie richtig verstanden hat. Jedenfalls brauchte man zu der Darstellung ein weißes Pferd. Da es aber in ganz Benau keinen Schimmel gab, behängte man ein braunes Pferd mit weißen Bettlaken. Ja, ja, die Benauer waren einfallsreiche Leute! In der Fastnachtszeit wurden auch Federn gerissen. Da kamen die Benauer Frauen zusammen, mitten um einen großen Tisch in der Spinte. Sie durften nicht husten und niesen und zogen die Federkiele aus den Federn. Diese würden in den Kissen zu sehr pieken. Viele Benauerinnen gingen auch in die Spinte, um ihren Flachs zu spinnen. In dem großen Raum trafen sich viele Frauen. Oft war die Spinte ein großer Raum im Gemeindehaus. Leider ist nicht überliefert, wo sich die richtige Benauer Spinte befand.
Ostern war auch ein schönes Fest für die Kinder. Die Mutter färbte unzählige gekochte Eier in einem Sud aus junger Wintersaat oder aus Zwiebelschalen. Wenn sie schön eingefärbt waren, rieb sie sie mit einer Speckschwarte ein und hinterher glänzten sie wunderschön. Einmal, so um die Osterzeit, entwickelte die kleine fünf- bis sechsjährige Anna einen seltsamen Tick. Sie wollte unbedingt wissen, wie man glücklich wird. Leider konnte ihr keiner sagen, wie das funktioniert. Nur Onkel Paul Heinze wollte ihr ernsthaft helfen. Er sagte, wenn sie wirklich glücklich werden will, muss sie am 1. Osterfeiertag ganz zeitig, wenn es noch dunkel ist, aufstehen und ihn begleiten. Ja, Anna wollte. Anna erzählte mir, die Muter habe ihr zur Feier des Tages lächelnd ein neues weißes besticktes Schürzchen umgebunden. Es war noch finster, als der Onkel sie abholte. Sie liefen und liefen bis sie zu einer Stelle kamen, von der aus sie ein großes weites Feld übersehen konnten. Und da färbte sich auch der Himmel schon, denn die Sonne wollte aufgehen. Und der Onkel sagte zu ihr: „Du musst jetzt ganz genau in das Sonnenrot gucken. Wenn du Glück hast, wirst du darin das Osterlamm über die Sonne springen sehen. Wer es sieht, hat sein ganzes Leben lang Glück.“ Anna stierte und stierte, sah aber kein Osterlamm springen. Als der Sonnenball hervorlugte, sagte der Onkel, nun wäre die Gelegenheit vorbei. Die kleine Anna war sehr enttäuscht. Dieser Onkel Paul Heinze scheint jedenfalls ein rechter Schelm gewesen zu sein. Ich kenne gar nicht seinen Verwandtschaftsgrad in meiner Heinze-Sippe.
Ein paar Jahre später, auch um die Osterzeit, wollte Anna, wenn sie schon nicht glücklich werden konnte, wenigstens schön sein. Wie fast alle jungen Mädchen aus Benau ging sie am Ostermorgen, lange bevor die Sonne aufging, von einem nach Osten fließenden Bächlein, in einem Krug Wasser holen. Dieses Wasser konnte das ganze Jahr über aufbewahrt werden und sollte schön machen. Ja, es gab bei Benau eine kleine Quelle, deren Wasser nach Osten floss und am Rand des schmalen Baches wuchs Brunnenkresse. Die Mädchen durften während des Wasserholens kein Wort sprechen. Stumm mussten sie hin- und zurückgehen - egal, was passierte. Schon beim ersten Wort hätte das Osterwasser seine Wirkung verloren. Anna kam munter bei der Quelle an und wusch in dem klaren Wasser sogleich ihr Gesicht, ehe sie den Krug füllte und sich vorsichtig auf den Heimweg machte.
Kein Tropfen sollte verloren gehen. Wie das aber so ist, die Benauer Jungen wussten natürlich, was die jungen Mädchen am frühen Ostermorgen trieben und lauerten hinter den Büschen, um die Mädchen zu necken und zu ärgern, damit sie doch in ihrer Empörung sprechen würden. Auch unserer Anna passierte das. Ein junger Bursche stellte sich ihr in den Weg und wollte sie aus Spaß umarmen. Ohne einen Ton zu sagen, haute sie ihm eine mächtige Ohrfeige und rannte gemäßigten Schrittes davon. Leider war der Krug nur noch halb voll Wasser. Aber Anna hütete das kostbare Nass und benetzte so lange es reichte, ihr Gesicht damit. Und ja - ich kann es bestätigen, das Osterwasser hat Wirkung gezeigt. Anna hatte bis ins Alter eine schöne zarte rosig durchblutete Haut.
Nicht nur der Sommer - auch der Winter war schön in Benau, besonders wenn es große weiße Flocken schneite. Welche Lust, wenn Ernst August den großen gemütlichen Schlitten anspannte, alle Kinder einsteigen ließ; sie mit wärmenden Decken umhüllte und Karoline ihnen heiße große Steine unter die Füße legte und es vergnügt jubelnd auf eine Schlittenfahrt ging. Meistens zog die Schar in die umliegenden Nachbardörfer zum Kassieren von Rechnungen oder nach Grabig, nach Droskau oder Pitschkau zu Verwandten. Das Pferd hatte ein Glöckchen am Geschirr und fröhlich bimmelnd fegte der Schlitten durch die verschneite Niederlausitz. Herrlich war diese Winteridylle und blieb allen Kindern zeitlebens im Gedächtnis.
Und dann endlich Weihnachten! Weihnachten war die Krönung! Auch, wenn es viel bescheidener gefeiert wurde als es heutzutage bei uns üblich ist. Schon im ersten Ehejahr hatte Ernst August für seine zu erwartenden Kinder eine große Pyramide gebaut, die er mit vielen bunten Figuren schmückte und alle entzückte, wenn sie sich drehte. Paul erinnerte sich noch als alter Mann an eine Eisenbahn, die er aufziehen konnte, die er als kleiner Junge vom Vater zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. Und ein andermal war es ein großer Tuschkasten gewesen, dessen Geschmack er noch als 75jähriger auf der Zunge hatte.
Besonders das Weihnachtsfest im Jahr 1908 war allen Kindern von Ernst August und Karoline besonders eindrucksvoll in Erinnerung geblieben. Den Christbaum hatten sie gemeinsam mit dem Vater im Wald geschlagen. Aber bis es so weit war, dass man sich für einen Baum entschlossen hatte, war die Aufregung groß gewesen. Jedes Kind fand einen anderen Baum am schönsten. Marta, die kleinste von allen, durfte dann entscheiden, welcher Baum die Ehre haben sollte, ihr Christbaum zu werden. Marta bekam vor Stolz ganz rote Bäckchen. Alle anderen waren mit ihrer Wahl einverstanden.
Als sie nach der Heimfahrt mit großem Hallo ihr Wohnhaus wieder betraten, schlug ihnen der betörende Duft der vielen großen Christbrote entgegen, die im Vorratsraum lagerten. Tagelang hatte Karoline gebacken. Die beiden Lehrlinge waren zum Küchendienst abkommandiert worden, um gebrühte Mandeln auszupulen, zu hacken und die gewaltige Menge Teig zu kneten. Es war für alle ein hartes Stück Arbeit gewesen, aber jeder hatte mit Freude geholfen. Sie wussten auch warum! Jeder Angestellte sowie die Lehrlinge bekamen in jedem Jahr einen großen Weihnachtsstollen von vier Pfund Mehl geschenkt und mit auf den Weg, wenn sie über die Feiertage zur Familie nach Hause gingen. Bis es aber soweit war, wurde es den Kindern bei Androhung schlimmster Strafen verboten, heimlich in den Vorratsraum zu schleichen und die Rosinen von außen abzupolken. Na ja, ich bezweifle es sehr, dass das Paulchen sich durch die angekündigten Strafen abschrecken ließ, denn in jedem Jahr gab es merkwürdige kahle Stellen an den Broten. Der Christbaum wurde nie mit bunten Kugeln und Lametta geschmückt, sondern mit Pfefferkuchenfiguren, die Karoline selbst gebacken und mit Zuckerguss bemalt und verziert hatte. Rotbäckige Äpfel hingen mittels dünner Fäden, die an ihren Stielen verknotet wurden, an den grünen Zweigen und lachten den Kindern lustig entgegen. Die echten duftenden Wachskerzen, selbst gezogen, steckten in Kerzenhaltern, die auf einem langen Stab aus Metall saßen und in den Stamm des Baumes gedreht wurden bis sie festsaßen. Bestimmt hatte Ernst August sie selbst kunstvoll geschmiedet.
An einem
ersten Weihnachtsfeiertag, als Marta vier oder fünf Jahre alt gewesen war, war
sie am frühen Morgen rechtzeitig vor den anderen erwacht und hatte sich ins
Weihnachtszimmer geschlichen und den Weihnachtsbaum bewundert. Oh, da hingen
Sternchen und Kringel, Brezeln und kleine Männlein und Weiblein aus leckerem
Pfefferkuchen. Alles roch so verlockend und da mopste sie ein kleines Herzchen
und steckte es in ihren Mund. Hm - schmeckte das gut - und da nahm sie noch ein
Stückchen und noch ein Stückchen und als plötzlich die Tür aufging und die
Mutter herein trat und empört aufschrie, da war der Christbaum untenherum kahl
gefuttert.
Au weia - da war aber Karoline böse, und es gab auf Martas kleinem Po sofort
einige kräftige Klapse. Martas Gebrüll und Karolines Schimpfkanonaden weckten
die übrige Familie unsanft aus dem Weihnachtsschlummer und alle kamen
in ihren Nachthemden angestürzt. Marta wurde dazu verdonnert, gleich nach dem
Frühstück mit Tante Emilie nach Grabig zu fahren, um alles dem Opa Ernst zu
beichten. Der war das geliebte, aber auch gefürchtete Oberhaupt der Familie.
Marta starb fast vor Angst und sie war nicht im Stande, einen einzigen Ton
herauszubringen, als sie vor dem Großvater stand. Emilie, die alle nur Miele
nannten, musste von der schweren Sünde Martas berichten. Aufmerksam hörte sich
der Großvater die Geschichte an; dann schmunzelte er und sagte: „Ach Kinder -
es ist doch Weihnachten!“ Er zog die kleine verschreckte Sünderin auf seinen
Schoß und ihr fiel mit einem Plumps, ein großer Stein vom kleinen Herzen.
Wenn man den Erinnerungen glauben darf, lag zu Weihnachten immer Schnee in Benau - hoher dicker Schnee. Vor der Bescherung gingen alle erst zum Gottesdienst in die evangelische Kirche. Eine katholische Kirche gab es gar nicht in Benau, die Dorfgemeinde war evangelisch. Karoline mummelte alle ihre Kinder ganz dick ein, denn meistens war es bitterkalt und für Kinderfüße war der Weg ziemlich weit. Auch in der Kirche war es kalt, denn sie war ungeheizt. Nur Kerzen erhellten ihre Finsternis. Ihre Glocken dröhnten durch den frühdunklen Nachmittag und ängstigten die Kinder immer, aber dann wurde es schön und feierlich. Andächtig lauschten sie der uralten Geschichte von der Geburt Jesu, und sie sangen die Lieder mit der Gemeinde mit, die sie alle von Karoline schon kannten. Zuhause angekommen fand endlich die lang ersehnte Bescherung statt.
Im Jahre 1908 bekam Marta eine wunderschöne Puppe und Anna, die die älteste war, ein kleines Kaffeeservice. Darüber war Anna todunglücklich. Sie hätte auch viel lieber etwas zum Spielen gehabt. Marta erlaubte ihr nicht einmal die neue Puppe anzufassen und zu bewundern. Die Mutter erklärte Anna, dass sie doch schon ein großes Mädchen von acht Jahren wäre und viel zu groß für Puppen und wie lustig es doch sein würde, wenn alle zu ihr zum Kaffee kämen. Nein, Anna fand sich überhaupt nicht zu alt für eine Puppe und meuterte laut und beharrlich. Daraufhin nahm Ernst August sein Töchterchen mit in die Nebenstube und hat es mächtig verdroschen. Eine Weile nach der Bescherung setzte man sich zum Essen zusammen. Das ausgesprochene Lieblingsessen der Familie am Heiligabend waren in Sahne eingelegte saure Heringe mit Zwiebeln und Gürkchen zu Pellkartoffeln.
Manchmal, der Abwechslung wegen, tischte Karoline eine knusprig gebratene Gans auf. Auch in diesem Jahr 1908 war es so. Da fing die aufsässige Anna wieder mächtig an zu klagen und zu jammern; sie esse keinen Gänsebraten. Alle Augen richteten sich auf Ernst August, was er wohl dazu sagen würde. Aber die Eltern ließen Gnade walten. Anna bekam zu den Kartoffeln nur Butter hingestellt. Es war nämlich so gewesen: Als die Mutter die Gans rupfte und den Bauch anschließend aufschnitt, war Anna dabei gewesen und hatte zugesehen. Aber nun als ihr der Geruch der Därme in die Nase stieg, stank es so mächtig, dass sie sich übergeben musste. Keiner hatte ihr den Braten schmackhaft machen können. Sie aß Kartoffeln mit Butter zu Weihnachten. Später am Abend gab es immer noch Mohnkeulchen, Mohnklößel und Mohnpielen. Diese Aussichten versöhnten Anna mit ihrem Schicksal.
Nach dem Abendessen ging es in jedem Jahr hinüber zu den Großeltern Gottlieb und Auguste Heinze. Auch dort wurden sie liebevoll aufgenommen und beschenkt. Die Kinder sagten ihre Gedichte auf und schenkten selbst gefertigte Kleinigkeiten. Anna, die große Hoffnungen auf eine ähnliche Puppe, wie Marta sie bekommen hatte, hegte, wurde bitter enttäuscht. Da sie ja schon ein großes Mädchen war, bekam sie einen Nähkasten!
Am Vormittag des 1. Feiertages fuhren alle im Pferdeschlitten nach Grabig zu den Großeltern Ernst und Ernestine Neumann.
Alle freuten sich schon lange vorher auf das reichhaltige gute Essen, dass die Großmutter immer auftischte. Sie war eine wunderbare Köchin. Und der kleine Paul freute sich auf seinen Cousin Willi, der mal gerade ein Jahr älter war und mit seiner Mutter auf dem neuen Hof der Großeltern in einer Stube im Obergeschoss wohnte. Oh, mit Willi konnte man vergnüglich Faxen machen. Wenn Paulchen nichts einfiel, hatte Willi bestimmt eine aufregende Idee oder umgekehrt. Und dann besahen alle Heinze-Kinder neidisch Willis Geschenke. Die waren meistens besser als ihre eigenen. Miele hatte immer Kavaliere, die sich bei ihr einschmeicheln wollten und versuchten, Mieles Gunst durch Geschenke für ihren Sohn Willi zu erringen. Was ein Irrtum war; aber Willi profitierte davon. 1908 war Paul fasziniert. Willi hatte ein Ställchen mit Gatter aus Schokolade geschenkt bekommen, in dem sich 6 Schweinchen aus Marzipan tummelten. So etwas hatte Paul noch nie gesehen und ihm lief das Wasser im Munde zusammen. Seine Eltern kauften keine Schokolade. Auch nicht zur Weihnachtszeit, höchstens gab es mal Würfelzuckerstückchen.
Am Nachmittag setzte man alle Kinder wieder in den Schlitten, Willi auch noch dazu, und fuhr nach Droskau zur Patentante, die alle Muhme nannten. Sie war eine Schwester des Großvaters Ernst in Grabig; eine alte, kleine gebückte Frau, die schon ihr Leben lang in Droskau in einem kleinen strohgedeckten Haus lebte. Sie hatte nie einen Mann oder Kinder gehabt, lebte immer allein und erwarb ihren Lebensunterhalt als Magd bei einem Bauern und als Kräutersammlerin. Sie war eine herzensgute Frau, die in das Leben der Kinder viel Geborgenheit und Sonnenschein brachte. Alle liebten die alte Muhme in Droskau.
Die Eltern blieben nur kurze Zeit, verabschiedeten sich und ließen die fünf Kinder für mehrere Tage bei der Muhme. Einen größeren Gefallen hätten sie den Kindern gar nicht tun können. Ohne Aufsicht der Eltern bei der Muhme zu sein, war für sie das größte Vergnügen. Vor Freude kläffend sprang ihnen der dicke Mops der Muhme entgegen und stürmte dann mit ihnen in den Wald, der der Muhme gehörte. Sie durften sich immer ein kleines Tannenbäumchen im Wald selber schlagen und im Häuschen mit Strohsternen und Kerzen schmücken und noch einmal einen eigenen Heiligen Abend feiern - richtig und wieder mit Bescherung. Jedes Kind bekam einen lieblich duftenden Wachsstock, einen Steingutbecher mit einem Spruch darauf, Stifte für die Schiefertafel; die Mädchen eine Schürze und die drei Jungen Oskar, Paul und Willi je eine Pudelmütze. Da die Muhme, deren Namen nicht überliefert ist, eine sehr fromme Frau war, wurde viel aus der Bibel vorgelesen. Alle Fünf schliefen dann auf Strohdecken glücklich ein. Früh nach dem Morgengebet und dem Frühstück bekamen alle Kinder die Haare gebürstet und die Strubbelköpfe mit ein wenig Wasser geglättet. Dann ging es ab in die Droskauer Kirche. Für die Muhme war es die stolzeste Stunde eines jeden Weihnachtsfestes, wenn sie mit ihren fünf Patenkindern in die Kirche einmarschierte und am Gottesdienst teilnahm.
So zeigte sie allen Droskauern jedes Jahr, dass sie keine einsame, ungeliebte und von allen vergessene alte Frau war. Am Neujahrstag fuhr man wieder von zu Hause aus zu den Großeltern nach Grabig. Es spielte sich immer das gleiche Zeremoniell ab. Die Großeltern saßen in der Wohnstube und jedes Kind ging einzeln zu ihnen hinein, sprach seine Glückwünsche zum neuen Jahr aus und sagte ein kleines Gedicht auf. An eines konnte sich Anna noch im Alter erinnern. Sie sagte: „Das alte Jahr vergangen ist. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du in Kummer und Gefahr uns gnädig hast beschützt dies Jahr!“
Im darauf folgenden Jahr, am 6. Juni 1909, änderte sich alles. Der Schmiedemeister Ernst August starb. In Benau sagten die Dörfler laut und drastisch: „Der junge Heinze-Schmied hat sich totgesoffen!“ Es entsprach der absoluten Wahrheit. Immer öfter musste der kleine 6jährige Paul zum Händler Lehmann, Gustav laufen, um Schnaps für seinen Vater zu holen. Wenn er keinen Schnaps bekam, verdünnte er sich den Spiritus mit Wasser aus der Pumpe auf dem Hof und kippt ihn sich gierig in den Hals. Für alle Familienmitglieder war es ein Drama gewesen, mit ansehen zu müssen, wie er praktisch Selbstmord beging. Es war ein steiniger Weg für alle bis zu seinem Tod. Keiner konnte sich erklären, warum es so gekommen war. Warum so ein tragisches Ende?
Manchmal, wenn Gustav mit seinen vier Kindern Günter, Lothar, Reinhold und Hedwig bei den Eltern zu Besuch war, ging er auch zum Bruder Ernst August rüber, um ihm ins Gewissen zu reden – leider erfolglos. Der Bruder trank weiter.
Nun war der Kampf vorbei. Ernst August war nur 37 Jahre alt geworden und hatte seine Frau Karoline im Alter von 28 Jahren zur Witwe mit vier Kindern gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Karoline sich lange der Trauer um ihren Mann hingeben konnte. Vielleicht weinte sie nachts im Bett ein paar Tränen; aber das glaube ich auch nicht. Ich vermute, wenn sie sich hinlegte, schlief sie vor Erschöpfung gleich ein. Haus und Hof, Tiere und Garten wollten versorgt werden, dazu kam die Beköstigung der Gesellen und Lehrlinge und natürlich ihrer vier Kinder.
Hinzu kamen die Geldsorgen. Viel Bargeld war nicht vorhanden. Praktisch lebte sie von dem Wenigen, das die Schmiede ihr einbrachte. Ernst August fehlte an allen Ecken und Kanten. Er hatte alles bestimmt und gemacht. Karoline hatte von der Schmiedearbeit keine Ahnung. Sie setzte einen Gesellen als Geschäftsführer ein und er führte dann die Schmiede; jedoch es ging mehr schlecht als recht. Karoline kam dahinter, dass er sie betrog. Er wirtschaftete in die eigene Tasche und außerdem hat er auch gesoffen. Die Benauer sagten nicht „der trinkt“ oder „er ist dem Alkohol verfallen“, nein - sie sagten klar und deutlich „der säuft“.
Karoline entließ ihn, setzte einen anderen Gesellen ein, aber viel besser wurde es nicht. Die Schmiede brachte nichts mehr ein und sicherte nicht mehr den Lebensunterhalt für sie und die vier Kinder.
Es geschah etwas seltsam Rätselhaftes und keiner weiß mehr wie es dazu kam und warum. Die Heinze-Familie sagte sich von ihr und den Kindern los. Sie sahen zu wie sie ins Elend fiel, aber Gottlieb und Auguste gewährten ihr keine Unterstützung. Auch nicht die Brüder, einschließlich der Orgelbauer, dem es ja finanziell sehr gut ging. Warum das so war, ist leider nicht überliefert. Vielleicht hat es einen Grund gegeben, vielleicht auch nicht. Heute darüber zu spekulieren, ist zwecklos. Alle Unterstützung, die Karoline Heinze gewährt wurde, kam aus Grabig von ihren Eltern und von ihrem Bruder Paul.
Karoline ging auf die Felder der Bauern arbeiten und die Kinder mussten mithelfen, das täglich nötige Brot zu verdienen. Mit einem Bauern sprach sie ab, dass drei Reihen Kartoffeln der Lohn für ihre geleistete Arbeit waren. Denn Kartoffeln waren ihre Hauptnahrung - Brot weniger, denn das musste gekauft werden. Wenn das Korn geerntet wurde, mussten alle Kinder mit auf die Felder.
Die Feldarbeit ging dann in drei Etappen. Zuerst mähten die Schnitter mit Sensen das Korn. Frauen griffen es und legten es zu Bündeln zusammen. Kinder drehten Strohbänder und banden die Bündel zu Garben zusammen und stellten sie zu Hocken gegeneinander auf, damit von allen Seiten Luft herankam und um zu trocknen. War es trocken fuhr man es mit Ochsen- oder Pferdewagen hoch gepackt in die Scheune. Gedroschen wurde noch mit dem Flegel auf der Tenne. Diese hatte einen Lehmboden, über dem man die Garben wieder aufband und so lange mit dem Flegel auf sie einschlug, bis die Körner heraus fielen.
Das nun leere Stroh, das übrig lieb, harkte man aus, und gebrauchte es hauptsächlich für die Viehställe. Das Korn schaufelte man in Säcke.
Für die Kinder war es harte Arbeit, denn sie durften nicht einfach weglaufen, wenn sie keine Lust mehr hatten. Sie mussten mit den Erwachsenen mithalten bis zur völligen Erschöpfung.
Anna war 9 Jahre alt und wurde als kleine Hilfsmagd zu einem Bauern geschickt. Oskar und Paul (7 und 6 Jahre alt), wurden stundenweise mit dem Sammeln von Disteln auf den Feldern beschäftigt. Für einen halben Tag betrug der Lohn 25 Pfennige. Das Geld durften sie natürlich nicht behalten, um vielleicht Zuckerstangen zu kaufen. Jeden einzelnen Pfennig mussten sie der Mutter übergeben. Als Paul acht Jahre alt war, bekam er eine feste Anstellung bei einem Bauern, der große weite Felder besaß. Paul musste nun Steine sammeln und nebenbei die Disteln ausreißen, die er fand.
Karoline hatte am Bahndamm ein Stück Wiese für Grünfutter gepachtet. Wenn sie das Gras geschnitten hatte, schleppte sie es in einem riesigen Bündel zu ihrer Ziege heim. Aus der Milch, die sie sammelte und aufstellte, konnte sie wenigstens etwas Butter herstellen und gleichzeitig war doch etwas Milch im Haus. Aber hauptsächlich gab es Schmalzbrot, wenn es überhaupt Brot gab. Ein Schwein hatte sie auch im Stall, aber das musste, wenn es erst mal geschlachtet war, lange ausreichen. Rindfleisch war für sie unerschwinglich. Ein Kilo kostete 60 Pfennige. Die Hauptnahrung Karolines und der Kinder waren Pellkartoffeln mit Leinöl und Salz und Quetschkartoffeln mit Sauerkraut oder Bratkartoffeln mit Rotkohl. Manchmal kam zur Freude der Kinder Hering auf den Tisch. Paul erzählte später, er schmiss dann die Heringsseele an die Decke, an der sie immer kleben blieb.
In jeder Woche, die Gott werden ließ, kam einmal der Grabiger Großvater Ernst mit seinem Pferdewagen nach Benau, um zu sehen, wie es seiner Tochter Karoline und den Kindern ging. Im Winter, wenn alles verschneit war, kam er mit dem Pferdeschlitten und wer von den Kindern das Glöckchen bimmeln hörte, alarmierte mit einem lauten Jubelschrei die anderen. Wenn der Großvater nicht kommen konnte, schickte er seinen Sohn Paul, Karolines Bruder. Mit seinen Besuchen löste er jedes Mal große Freude aus. Alle wussten, dass er immer gute und nötige Lebensmittel mitbrachte. Kartoffeln, Mehl, mal etwas Sahne, ein Stückchen gute Butter von den Milchkühen aus Opas Stall, die natürlich ganz anders schmeckte, als Karolines Ziegenbutter. Mit der Hilfe des Großvaters gelang es, die vaterlose Familie ausreichend mit Nahrung zu versorgen. Karoline musste ja auch die Männer, die die Schmiede recht und schlecht betrieben, beköstigen. Was wirklich schwierig war, denn die Armut fing an sich immer mehr auszubreiten.
Dieser ewige Kampf ums Überleben veränderte Karoline zum Nachteil. Sie wurde hart, und es gab keine Zärtlichkeiten mehr für die Kinder. Es zählte eigentlich nur noch, was die Kinder durch Nebenverdienste dem Haushalt beisteuern konnten. Der Großvater erkannte die Lage und so oft es ging, lud er die kleine Bande auf sein Fuhrwerk und nahm sie für etliche Tage mit zur Großmutter Ernestine auf den kleinen Bauernhof. An die Herzenswärme, die er dort erfuhr, erinnerte sich Paul sein Leben lang. Und da gab es auch Juck, den großen Bernhardiner, der zum Futter holen vor einen nicht zu großen Wagen geschirrt wurde und seine Aufgabe als Ziehhund duldsam erfüllte. Wenn Paul und Juck Mittagspause machten, krochen sie beide in Jucks Hundehütte und kuschelten sich aneinander. Jucks Flöhe krabbelten zu Paul und Pauls Flöhe lustig zu Juck. Wegen der Ställe auf dem Hof konnte es passieren, dass Schmutz auf die Fußböden der Wohnräume gelangte. Zum Schutz wurden diese wochentags mit kurz geschnittenem Stroh ausgelegt. Zum Sonntag wurde es entfernt und die Großmutter streute das ganze Haus mit weißem Sand aus. Der Miele, die ja mit ihrem Sohn Willi im Obergeschoss wohnte, unterlag das Buttern und das Ausliefern von Butter, Sahne, Quark und Eier.
Im Keller standen große Rahmschüsseln, in denen die fette Milch säuerte oder entrahmt wurde. Man butterte in einem hohen schmalen Fass, das 20 Liter Sahne aufnahm. Durch das Loch im Deckel war ein langer Stiel gesteckt, an dem unten eine Scheibe mit Löchern stark befestigt war und oben am anderen Ende einen Griff hatte, damit man den Stock mit der Scheibe in der eingefüllten Sahne kräftig rauf und runter stucken konnte. Das musste man ermüdend lange tun, aber schließlich ballte sich das Fett der Sahne zu Klumpen zusammen und war Butter. Die Flüssigkeit, die übrig blieb, war die so genannte Buttermilch, die man abgoss und extra verwertete.
Die Butter wurde noch in sauberem Wasser ausgeknetet und vielleicht zum Schluss etwas gesalzen. Im Sommer, wenn die Kühe viel Grünfutter gefressen hatten, war die Butter appetitlich gelber als im Winter.
Auch die Großeltern lebten sehr sparsam und einfach. Es kam eigentlich nur auf den Tisch, was von den eigenen Feldern und aus eigenen Ställen stammte. Außer Salz, Zucker und Gewürze war es nicht viel, was zugekauft wurde. Aber die Großmutter kannte ihre Leckermäulchen und ließ ihnen begehrte Häppchen zukommen. Ganz früh morgens, wenn der Großvater im Stall beschäftigt war und Miele und Paul die Kühe melkten, schlich Ernestine so manches Mal heimlich in die Stube, in der die vier Enkelkinder in ihren Betten auf Strohsäcken schliefen, angelte die Schinkenkeule herunter, die an einem Haken unter der Stubendecke hing, säbelte eine schöne zarte Scheibe herunter, schnitt sie auf einem Brettchen in kleine Würfel und stopfte sie in die Mäulchen der schon lauernden Kinder. An jedem Abend gab es Pellkartoffeln, meistens mit Quark und Leinöl. Aber die Kinder durften die begehrte Butter dazu essen. Vorher hatte Ernestine in nassen Holzförmchen die Butter zu kleinen Stücken gepresst, so dass ein jedes Kind eine gemusterte Scheibe oder eine Figur auf dem Teller vorfand. Das war lustig. Jeder der vier versuchte nun den Genuss sehr lange hinauszuziehen und aß nur winzige Butterteilchen zu möglichst vielen Kartoffeln, um am Ende einen Riesenhaps Butter hinterher schieben zu können. Neidisch schielten sie auf den, der am Ende den größten Haps hatte. Sie durften aber die Pellkartoffeln nur mit einem Löffelstiel pellen. Messer wurden ihnen nicht anvertraut.
Oh, wie spannend war es, wenn Onkel Paul Geschichten aus alter Zeit erzählte. Dann lauschten die Kinder still und andächtig. Onkel Paul erzählte ihnen viel von seinem Großvater, dem Vater von Opa Ernst. Er war bei den Husaren des Generals Hans Joachim Ziethen gewesen. Die Ziethen-Husaren hatten im 7jährigen Krieg große Schlachten gewonnen und Onkel Paul war wahnsinnig stolz auf seinen verstorbenen Opa. Sein Opa hatte in den vier Jahren seiner Dienstzeit nur einmal Urlaub bekommen. Um nach Hause zu kommen, musste er zu Fuß von Wittenberg nach Sorau laufen. Für das Stückchen von Sorau nach Grabig fand er meistens einen Bauern, der ihn auf seinen Pferdewagen aufsitzen ließ. Es gab ja noch keine Eisenbahn. Und dann zeigte Onkel Paul ihnen das große lange Gewehr, das immer neben seinem Bett stand; ein Gewehr seines Großvaters von 1870/71. Es hatte noch eine Pulverpfanne und ein Zündhütchen. Die Kugeln musste man selber gießen; aber das konnte er, sagte Onkel Paul jedenfalls. Und am Ende holte er noch eine Kiste unter seinem Bett hervor, worin - umgeben von duftenden Kräutern, die die Motten abschreckten - die Uniform des alten Ziethen-Husaren lag. Diese wurde immer zum Höhepunkt. Onkel Paul erzählte dann weiter von seiner lieben Großmutter, deren Namen keiner ihrer Nachkommen mehr kennt. Als sie im Sterben lag und er sich Abschied nehmend über sie beugte, hatte sie ihm heimlich 20 Taler in die Hand gedrückt. 20 Taler waren damals eine Menge Geld. Und er erzählte, dass damals noch im offenen Kamin, in einem Topf auf einem Dreifußling über offenem Feuer gekocht wurde.
Wenn zum Großvater Ernst Bäuerinnen kamen, die eine kranke Brust hatten und ihn baten, sie zu heilen, wurde Paul zu seinem Leidwesen immer aus der Stube geschickt. Darüber ärgerte er sich jedes Mal. Er hätte viel lieber die Anatomie des weiblichen Körpers studiert, der langsam anfing, ihn sehr zu interessieren. Ernst Neumann war nicht nur Bauer, Schafmeister und Heiler, sondern auch ein echter Rechenkünstler. Die Leute kamen zu ihm, um sich Zinsen, Gewinne oder Verluste ausrechnen zu lassen. Auch Paul profitierte etwas von der Begabung seines Großvaters. Paul war ja schon ein großer Junge und besuchte die Dorfschule in Benau. Wenn Paul mal wieder, wie so oft, mit Zahlen auf dem Kriegsfuß stand, gab ihm der Opa Nachhilfe, die stets wirksam war.
Ja, ja - die Schule! Mit ihr stand der kleine Paul etwas auf dem Kriegsfuß. In der Benauer Dorfschule gab es vier Klassen. Jede Klasse umfasste 80 Kinder aus zwei Abteilungen. Es wurden immer zwei Jahrgänge zusammengelegt. Also gab es damals in Benau 320 Kinder, die von vier Lehrern unterrichtet wurden. Die alten Klamotten, anders kann man seine Bekleidung, die Paul auf dem Leib trug, nicht bezeichnen, waren die immer nur abgelegten, ausgewachsenen Sachen von seinem Bruder Oskar. Oskar musste immer sofort, wenn er aus der Schule kam, Hilfsarbeiten in der Schmiede übernehmen - bis zu seiner Schlosserlehre, die er durch eine Zeitungsannonce in Schaksdorf bei Forst fand.
Während seiner gesamten Schulzeit besuchte Paul den Unterricht im Sommer barfuss, denn er besaß keine Lederschuhe. Im Winter trug er Holzlatschen, die in der Familie selbst hergestellt wurden. Dazu trug er dicke, vom Großvater in Grabig gestrickte Socken, auf die starker dicker Filz genäht wurde. Man sagte auch Fries. Ich war immer sehr verwundert, wenn er mir erzählte, dass er in diesen Socken sogar auf dem Dorfteich Schlittschuh laufen konnte. Leider besaß er keine Schlittschuhe aus Metall, aber er schnallte sich mit Riemchen oder Strippe ganz bestimmte Schweineknochen unter die Füße. Das soll unter den armen Buben damals üblich gewesen sein. Bei Androhung von schwerer Prügelstrafe, die auch gerne verabreicht wurde, war es verboten, auf dem Schulhof mit Schneebällen zu werfen. Leider hielt sich das unternehmungslustige Paulchen nicht an dieses Verbot. Er schmiss doch einen scharfen Ball und traf den Lehrer Raschich genau aufs Auge. Es schwoll dunkelblau an und genauso blau und geschwollen war Pauls kleiner Hintern nach der vollzogenen Prügelstrafe.
Ein Erlebnis mit einem seiner Lehrer verfolgte Paul sein ganzes Leben lang. Paul fühlte sich ewig schuldig daran, dass es so gekommen war. Im Gesangsunterricht beim Lehrer Gohlke sang Paul unentwegt falsch. Die Kinder lernten das Lied „Im schönsten Wiesengrunde“. Eine Stelle konnte und konnte Paul nicht kapieren. Er fand einfach nicht den richtigen Ton. Lehrer Golisch regte sich schrecklich auf und versuchte mehrmals Paul auf den richtigen Ton zu bringen. Vergeblich! Paul traf ihn nicht. Da wurde Lehrer Golisch ganz verrückt und haute seine Geige mit aller Wucht auf Pauls Kopf, so dass sie in Stücke sprang. In der Pause verstarb der Lehrer durch die Aufregung an einem Gehirnschlag.
Am allerschönsten in seinem Leben waren für Paul in seiner Kindheit die Schulferien. Bis zu seinem 10. Lebensjahr durfte er sie mit Anna, Oskar, Marta und auch Willi bei der Muhme in Droskau, in ihrem kleinen strohgedeckten Häuschen verbringen. Hei! Das war da ein Leben! Sie brauchten sich während der ganzen Zeit nicht waschen! Die Muhme ging als Magd arbeiten und so waren die Kinder tagsüber sich selbst überlassen. Die Nachbarn waren weniger begeistert und riefen sich schon ehe die Kinder da waren gegenseitig zu: „Die Brut kommt wieder!“ Natürlich stellten die Kinder die Bude der Muhme auf den Kopf. Aber diese kleine, gebeugte alte Frau war nie aus der Ruhe zu bringen und ertrug alles mit großer Geduld. Die eine Grenze ihres Grundstückes bildete ein Wassergraben. In dem panschten die Kinder fast den ganzen Tag herum und wurden nicht müde, es zu tun. An ein Verbot der Muhme hielten sie sich immer. Sie durften nicht in eine kleine Kammer, in der die Muhme viele Schnapsflaschen mit in Alkohol angesetzte Beeren und Kräuter für Liköre und Medikamente aufbewahrte. Daran zu gehen, war strengstens verboten. Darüber hatte der Großvater ein strenges Wort mit ihnen geredet. Die Muhme hatte sich aber doch eine Strafe für die Rasselbande ausgedacht, wenn sie, wie es öfter vorkam, über die Strenge schlugen, wie es so schön heißt. Alle Kinder fürchteten sich vor dieser Strafe. Wenn es wieder einmal soweit war, mussten sich alle fünf zur Muhme um den Tisch setzen und dann wurde eine Stunde lang abwechselnd aus der Bibel vorgelesen. Das fanden die Kinder, war eine schreckliche Strafe.
Bei der Muhme wurde sowieso schon viel gebetet. Früh begann der Tag mit einem Morgengebet und endete abends mit einem Abendsegen. Wenn zur Erleichterung der Nachbarn die Ferien vorbei waren, kam der Großvater sie abholen. Er kam immer mit einem Planwagen und versteckte die Kinder im Inneren, damit keiner sie sehen konnte, denn sie sahen schrecklich schmutzig aus. Manchmal kletterten sie nämlich sogar durch den offenen Kamin in die Hütte der Muhme. Zu Hause wurden sie auf der Stelle in ein Waschfass gesteckt und von Karoline eigenhändig geschrubbt. Solange geschrubbt, bis sie überzeugt war, dass sie ihre Kinder wieder der Benauer Dorfgemeinschaft präsentieren konnte.
Wenn Paul manchmal mit dem Zug zu den Großeltern nach Grabig fahren sollte, lief er lieber heimlich zu Fuß und kaufte sich für das Fahrgeld Zigarren. Es gab damals neumodische Automaten, wenn man in die einen Groschen steckte, der klingelnd in eine unbekannte Tiefe fiel und man dann auf einen Knopf drückte, ging eine kleine Klappe auf und der Automat erlaubte, dass man drei Zigarren aus ihm entnahm. Paul war hingerissen. Eine Zigarre bekam immer Willi in Grabig, die zweite rauchte Paul auf dem Marsch, den er nun vor sich hatte und die dritte war für den Heimweg bestimmt.
In jedem Jahr gab es eine Kirmes in Benau und alle Benauer freuten sich schon Wochen vorher auf das tagelang bunte Treiben. Es gab jedes Mal viele aufgebaute kleine Stände und eine Bude, in der man für ein Eintrittsgeld Kuriositäten, meistens in Spiritus eingelegt, besichtigen konnte, die Paul aber mangels Geld niemals ansehen durfte. Immer gab es auch einen „Haut den Lukas“, an dem die Männer und solche, die sich schon für Männer hielten, ihre Kräfte messen konnten. Da gab es eine Schießbude und oft einen berühmten Entfesselungskünstler, der seine Muskeln in der Sonne spielen ließ, wenn er bemerkte, dass eine Benauer Dorfschöne ihn heimlich betrachtete. Für die Kinder war aber auf alle Fälle die größte Attraktion das Karussell. Paul wurde dann immer begeisterter Karusselldreher. Er schob und schuftete fast bis zum körperlichen Zusammenbruch. Zur damaligen Zeit wurden Karussells noch nicht elektrisch angetrieben, sondern von Jungen durch Körperkraft gedreht. Oben in der Kuppel gab es eine feste Plattform, in der mehrere Jungen durch Schieben die Konstruktion zum Drehen brachten. Es war Knochenarbeit; aber ein beliebter und begehrter Posten. Geld gab es nicht; aber wer fünfmal mitgedreht hatte, bekam eine Freifahrt.
Sollte es vorkommen, dass irgendwo in Benau ein Pferd verendete, schickte Karoline sofort eines ihrer Kinder hin, um Fett aus dem Kadaver zu lösen und heimzubringen. Sie verwendete das Fett, nachdem es ausgelassen war, für ihre Tranfunzeln. Es gab noch kein elektrisches Licht auf ihrem Grundstück. Alle Kinder empfanden es als außergewöhnlichen Feiertag, wenn die Muhme unverhofft zu Besuch kam und für jeden ein kleines Fläschchen süßen Himbeersaft aus selbst gesuchten wilden Beeren mitbrachte. Ferien bei der Muhme gab es nicht mehr.
Im Alter von 10 Jahren, also 1913, musste Paul sein Zuhause verlassen. Seine Muter Karoline verdingte ihn für Geld als Ochsenjungen an den Bauern Boemack. Als Paul mir das alles aus seiner Kindheit erzählte, wählte er selbst den altmodischen Ausdruck „verdingen“. Es heißt nichts anderes als vermieten, verpflichten oder in Dienst gehen. Kinderarbeit war damals absolut üblich. Darüber zerbrach sich niemand den Kopf. Man nahm es wie selbstverständlich hin, dass Kinder armer Leute verdingt wurden, um sich ihr tägliches Essen selber zu verdienen. Paul klagte auch zu niemandem darüber. Es war so und er hatte es zum Glück gut getroffen beim Bauern Boemack.
Seine Mutter Karoline arbeitete selbst als Magd auf den Boemackschen Feldern. Es gab auf dem Hof keine eigentliche Bäuerin, die war verstorben. Zwei Schwestern, die freundlich und gut mit Paul umgingen, halfen ihrem Bruder den Hof zu bewirtschaften. Paul durfte zu den Mahlzeiten so viel essen wie er wollte und das war für den Heranwachsenden das Wichtigste im Leben. Ausbeutung hin - Ausbeutung her - Pauls Augen strahlten und sein Herzchen klopfte aus Vorfreude in seiner schmächtigen Kinderbrust, wenn die gekochten Pellkartoffeln in der Mitte des Tisches zu einem hohen dampfenden Haufen aufgeschüttet lagen und verheißungsvoll nach Kümmel dufteten. Rundherum stand für jeden ein Näpfchen mit Leinöl und Salz. Das Öl musste man sich einteilen, aber Kartoffeln durfte jeder essen, bis er ganz doll satt war. Pellkartoffeln mit Leinöl, ob mit Quark oder ohne, sei dahingestellt, scheinen in Benau ein Grundnahrungsmittel gewesen zu sein. Beides kam ja auch von den eigenen Feldern. Eigentlich kam alles, was man aß, aus eigener Erzeugung.
Es gab auch oft Quetschkartoffeln oder Bratkartoffeln mit Rotkohl, Weißkohl. Es gab Speckstippe oder auch mal Heringsstippe, aber die war schon was Besonderes. Heiß geliebt wurden im Winter Kohlrüben mit Rauch- oder Pökelfleisch oder Sauerkraut. Ob Bauer, Knecht oder Ochsenjunge, jeder durfte bei Boemacks essen, so viel er schaffte. Mit Dankbarkeit erinnerte sich Paul sein Leben lang daran. Sonntags, wenn er seine Ochsen versorgt hatte, durfte er nach Hause gehen. Aber er verlor bald den innigen Kontakt zu seinen Geschwistern. Von der Mutter erfuhren sie so gut wie keine Liebe. Ihr Leben war nach dem Tod von Ernst August zu hart geworden, so dass ihr Herz sich auch verhärtet hatte. Nur zu der kleinen Marta bestanden noch zärtliche Gefühle in Paul und sie tat ihm so leid. Die kleine Marta musste im Morgengrauen Zeitungen austragen, um etwas zu ihrem Lebensunterhalt beizusteuern. Aber Marta ängstigte sich sehr vor der Finsternis und weinte schrecklich und wollte nicht gehen. Oft versohlte Karoline ihr den kleinen Hintern, um sie hinauszutreiben. Paul konnte das Theater nicht aushalten und so übernahm er kurzerhand Martas Pflicht und trug die Zeitungen aus, ehe er das Vieh versorgte und anschließend in die Schule musste. Paul war als Ochsenjunge für acht Ochsen verantwortlich und schlief mit einem Knecht zusammen neben dem Stall in einer feuchten dunklen Kammer, in der das Geschirr- und Zaumzeug für die Tiere aufbewahrt wurde. Aber er durfte sich auch im Bauernhaus in der Küche aufhalten.
Im Sommer trieb Paul die Ochsen auf die Wiesen und Weiden. Jeder Ochse kam an eine Leine, die Paul in der Hand hielt. Vier Ochsen liefen vor Paul und vier hinter ihm. Er achtete sorgsam darauf, dass sein Lieblingsochse Max hinter ihm lief. Paul wusste, dass Max ihn liebte und ihm nie unverhofft etwas tun würde. Er kraulte ihn oft und steckte ihm manchmal eine Extra-Rübe ins Ochsenmaul. Schlimm wurde es für den noch schmächtigen Paul, wenn die Viecher untereinander stänkerten, durcheinander drängelten, so dass sie die Leinen verhedderten. Dann schrie Paul laut seine Befehle und drosch mit einem Knüppel so lange auf sie ein, bis sie sich beruhigten und er sie wieder neu anspannen konnte. Das war harte Arbeit für einen kleinen Ochsenjungen.
Auf den Wiesen konnte Paul auch nicht nur vergnügt im Grase liegen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Denn es gab keine Zäune, und Ochsen können verdammt schnell rennen, wenn sie das wollen oder ihnen das Grünzeug vom Nachbarn besser schmeckt. Dann musste Paul sie sofort auf die eigene Wiese zurücktreiben, wenn er keinen Ärger mit den Bauern haben wollte. Manchmal geschah etwas Seltsames. Dann sonderte sich Max von seiner Herde ab und kam ganz langsam auf Paul zugetrottet. Paul ahnte dann schon, was kommen würde. Er stellte seine Beine etwas auseinander und richtete sich so aus, dass er einen festen Stand hatte und nicht so leicht umfallen konnte. In der Zwischenzeit war Max hautnah an Paul herangekommen und legte ganz langsam und behutsam seinen schweren Ochsenkopf zärtlich auf Pauls schmale Kinderschulter. Und so standen die zwei eine ganze Weile aneinandergeschmiegt und genossen die Zuneigung des anderen. Wenn der kleine dünne Paul anfing zu wanken, weil das Gewicht des Ochsenkopfes anfing wie Blei zu drücken, merkte Max das sofort. Er schnaubte mal ganz kurz und nass und trabte sehr zufrieden davon. Auch Paul war es nach dem Liebesbeweis immer wohler und leichter ums Kinderherz.
Paul durfte erst mit den Ochsen auf den Hof zurückkommen, wenn der Zug Grünberg-Christianstaat nach Sorau um 21.30 Uhr vorbei fuhr. Dann musste er sie anketten, tränken, musste selbst noch zu Abend essen und durfte endlich todmüde auf seinen Strohsack fallen. Vor 6.oo Uhr in der Frühe war seine kurze Nacht vorbei und die Schufterei begann aufs Neue. Da kann man es gut verstehen, dass der Ochsenjunge in der Schule die allergrößten Probleme bekam, denn er schlief fast an jedem Tag während des Unterrichts ein. Pauls Lehrer Schladder schrieb es sich daraufhin auf die Fahne, Paul von seiner Schlafsucht und Faulheit zu heilen - und zwar mit Dresche! Paul wurde regelrecht sein Prügelknabe.
Man ging zur damaligen Zeit in den Schulen allgemein sehr großzügig mit Züchtigungen um, aber Lehrer Schladder vollzog sie mit wahrem Genuss. Wenn Paul Dresche witterte, steckte er sich einige Hefte in die Hosen. Aber Lehrer Schladder witterte es und Paul musste die Hosenklappe aufmachen und die Hefte herausnehmen. Dann klemmte er sich den Kopf von Paul zwischen die Beine, schrie enthusiastisch aus Leibeskräften: „Sechs aus Leibeskräften!“ und drosch mit dem Rohrstock zu.
Der Lehrer Schladder gab seinen Plan, Paul durch Dresche von seiner Müdigkeit zu heilen, erst auf, als er sich mal wieder Pauls Kopf zwischen die Beine klemmte und los dreschen wollte. Paul in seiner Verzweiflung heulte aber dieses Mal nicht, sondern er biss dem Lehrer herzhaft in den Oberschenkel. Dieser brüllte auf vor Schmerz und tanzte wie ein Derwisch in der Klasse umher. Alle Klassenkameraden, die das Ereignis fasziniert beobachtet hatten, jubelten und feixten vor Vergnügen. Lehrer Schladder ging vorsichtiger mit seinen körperlichen Züchtigungen um, aber er rächte sich in dem Abgangszeugnis, das er Paul später ausstellte.
Die Winter bei Boemacks waren für Paul leichter. Paul hatte zwar dann auch noch die Pferde zu versorgen, denn der Knecht kam im Winter nicht, aber die Arbeit hielt sich in Grenzen. Seine Hauptarbeit bestand neben der Tierversorgung im Holzhacken. Und er liebte die Schlachtfeste. Es gab dann eine große Feuerstelle auf dem Hof, denn das geschlachtete Schwein musste gebrüht werden und wenn es zerteilt zur Weiterverarbeitung bereitlag, begann der Schlachter einzupökeln, Wurst zu machen und Fleisch in Gläser einzukochen. Paul durfte es in die Gläser stopfen und kam sich sehr wichtig vor. In den Kesseln dampfte die Wurstsuppe und das Wellfleisch. Jeder durfte sich satt essen.
Wenn alles verschneite, erlebte Paul bei Boemacks ruhige Winterabende. Die Frauen spannen, nähten oder flickten und alle sangen alte Volkslieder. Paul war gern bei Boemacks. Aber die Zeit schritt voran und wurde noch härter als sie schon war. 1914 brach der erste Weltkrieg aus. Karoline geriet in immer größere Nöte. Ihre einzige, sicher gewesene kleine Einnahmequelle, in der notdürftig am Leben erhaltenen Schmiede, ging verloren: der Hufbeschlag! Fast alle Pferde in Benau wurden von der kaiserlichen Armee beschlagnahmt und abgeholt. Ein paar alte Klepper blieben übrig, die kaum noch einmal neue Eisen brauchten. Auch Lehrlinge konnten in ihrer Schmiede nicht mehr ausgebildet werden, weil sie keinen Meister hatte. Zum Glück gelang es ihr einen Gesellen zu ergattern, der für die kaiserlichen Soldaten zu alt war. Zwei halbwüchsige Gehilfen unterstützten den Gesellen und so konnten die anfallenden Aufträge der Benauer - wie Reparaturen an Pflügen, Wagen und der wenige Hufbeschlag ausgeführt werden.
Die jungen und gesunden Männer aus Benau mussten in den Krieg ziehen, ob sie wollten oder nicht. Im Laufe der Zeit und Jahre nahmen immer mehr Kriegsgefangene ihren Platz als Helfer in der Landwirtschaft ein.
Karolines Bruder Paul Neumann aus Grabig wurde zum Glück nicht zum kaiserlichen Heer eingezogen. Er bewirtschaftete mit seinem Vater Ernst zusammen den kleinen Hof und ging nebenbei als Schlächter und als hochgeschätzter Wurstmacher auf die Bauernhöfe seiner Umgebung.
Karolines älteste Tochter Anna feierte 1914 ihren 14. Geburtstag und musste auch ihr Zuhause verlassen. Sie trat eine Lehre in einem Benauer Milchbetrieb an, wohnte auch dort und wurde zur Meierin ausgebildet Nun hatte Karoline nur noch Oskar und die kleine Marta zu versorgen. Oskar verdiente sich bereits sein Brot selbst, indem er nach der Schule als Gehilfe in der Schmiede arbeitete. Es schien leichter für Karoline zu werden. Aber da traf sie schon einer neuer Schlag.
Am 15. Mai 1916 verstarb ihr Vater, der Schafmeister, Heiler und Landwirt Ernst Neumann in Grabig. Er starb nicht als armer Schlucker. Außer seinem kleinen Bauernhof besaß er in Grabig mehrere Grundstücke und eines in Sorau. Er hinterließ seine Frau Ernestine, die ihn um viele Jahre überlebte, und seine Kinder wohl versorgt, was damalige dörfliche Verhältnisse betrifft. Höchstwahrscheinlich starb er am schlimmen Rheuma, das ihn jahrelang gequält hatte. In der letzten Zeit - vor seinem Tod - waren eine Schulter und der Arm beängstigend dick angeschwollen. Er hatte selbst so vielen Menschen helfen können, aber an sich selbst versagte seine Heilkunst.
Immer blieb Paul die Beerdigung seines Großvaters in lebhafter Erinnerung. Mit großem Stolz erzählte er mir von dem unglaublich langen Trauerzug, der dem Sarg auf dem Weg zum Friedhof folgte. Weil er selbst im Blickpunkt aller Trauernden stand, hatte er extra für diesen Tag ein paar neue Hosen und von irgendjemandem ein paar passable Schuhe geborgt bekommen. Ihm war die ehrenvolle Aufgabe zugefallen, als Lieblingsenkel vor dem Sarg herzugehen und auf einem Samtkissen die Orden zu tragen, die sein Großvater in irgendeinem Krieg verliehen bekommen hatte. Paul vermisste seinen Großvater, so lange er selbst lebte. Von ihm hatte er sich aufrichtig geliebt gefühlt. Er war seine Bezugsperson für allen großen und kleinen Kummer gewesen. Ihm hatte er alles sagen können. So manches Mal hatte er Paul besucht, wenn der mit den Ochsen auf der Weide war und er lehrte ihn etwas, was ich später oft an Paul bewunderte.
Paul kannte alle Pflanzen, jede Grassorte, jede Blume, jeden Baum, jedes Blatt, jeden Vogel und jeden Käfer. Paul leistete oft erste Hilfe und konnte sehr gut Verbände anlegen, wenn es nötig war.
1917 war Paul 14 Jahre alt und verließ die Dorfschule in Benau. Sein grandioses Abschlusszeugnis hat überlebt und ist auch nachstehend zu bewundern. Nun sollte die Konfirmation in der Benauer Kirche erfolgen. Paul bekam vom Herrn Pfarrer, dessen Name mir leider nicht überliefert wurde, den Auftrag, am Abend vor der Einsegnung die Kirche recht schön auszuschmücken, damit sich die Gemeinde so richtig an ihrem Anblick erfreuen kann. Gesagt - getan! Karoline steuerte viele Blumen aus ihrem Garten bei wie viele anderen Benauer auch und Paul schmückte die Kirche wirklich wunderschön aus. Nur leider, als er so beim Dekorieren war, entdeckte er die Schachtel mit den Oblaten, die der Pfarrer für seine Zeremonie nötig brauchte. Paul freute sich und kostete eine und dann noch eine und noch eine, und als er zu sich kam, war die Schachtel leer und Paul erstarrte vor Schreck. Er wusste nicht, was er tun sollte und so tat er erst einmal gar nichts, sondern wartete ab, was auf ihn zukommen würde. Der nächste Tag brachte in der Frühmesse Pauls Schandtat ans Licht.
Der Pfarrer entdeckte die leere Oblatenschachtel. Auf der Stelle wurde Paul in die Kirche geholt, denn der Verdacht fiel natürlich sofort auf ihn. Der Missetäter leugnete auch gar nicht, sondern gestand sofort. Nun verdonnerte der Herr Pfarrer den Sünder zuerst zu einer angemessenen Tracht Prügel. Dafür war es nötig, dass Paul selbst zur Frau Pfarrerin ging und in aller Form höflich um den Rohrstock bitten musste. Der Pfarrerin war Paul in dieser Angelegenheit kein Unbekannter, denn Paul war auf Dresche abonniert. Den Stock musste er zum Herrn Pfarrer bringen, der schon begierig auf ihn wartete und dann legte er sich den Paul übers Knie und verdrosch ihn nach Strich und Faden, dass Paul vor Striemen auf seinem Hintern eine Woche nicht sitzen konnte. Außerdem wurde er für diesen Sonntag von der Konfirmation ausgeschlossen und 8 Tage später eingesegnet, was keinen sehr traf, denn Karoline hatte sowieso keine Feier vorbereitet. Weder an diesem noch am nächsten Sonntag wurde gefeiert. Als Paul seine Strafe erhalten hatte, beorderte der Pfarrer einen anderen Jungen, sich aufs Fahrrad zu schwingen, in ein Nachbardorf zu radeln und den dortigen Pfarrer zu bitten, den Benauern mit Oblaten auszuhelfen. Sang- und klanglos segnete man Paul am nächsten Sonntag ein. Er verbrachte den weiteren Tag bei den kriegsgefangenen Russen, bei denen er sich gerne aufhielt. Sie fütterten ihn mit Keksen, die sie aus ihrer Heimat geschickt bekommen hatten.
Paul liebte besonders ihre schwermütigen Lieder. Nach Pauls Entlassung aus der Schule und seiner Konfirmation war auch seine Zeit bei Boemaks vorbei. Er galt nun als halber Erwachsener und der Posten eines Ochsenjungen ging an einen anderen jüngeren, armen Jungen über. Paul arbeitete bis er eine Lehrstelle gefunden hatte, in einer Benauer Mühle und wohnte dort auch.
Der Orgelbaumeister Gustav Heinze kam noch ab und zu nach Benau, um nach seinem alten Vater zu sehen. Auguste war schon 1912 aus dem Leben geschieden. Er war längst mit einer Hedwig Kayser verheiratet und hatte mit ihr vier gesunde Kinder. Da waren drei Jungen - Lothar, Reinhold und Günter. Die Tochter, die wie ihre Mutter auf den Vornamen Hedwig hörte, war genau wie Paul - 1903 - geboren. Alle vier Kinder von Gustav waren im gleichen Alter wie die Kinder seines Bruders, des verstorbenen jungen Schmiedemeisters Ernst August.
Der Krieg setzte Gustav schwer zu. Keiner hatte Geld, um eine neue Orgel zu bestellen. Seine besten Gesellen waren beim Kaiserlichen Heer. Aber gerade, weil kein Geld für neue Orgeln vorhanden war, konnte Gustav den Betrieb in Sorau über Wasser halten und über die schwere Zeit hinüberretten, denn es gab sehr viele Reparaturaufträge zu erfüllen und die Orgelbauwerkstatt brauchte nicht geschlossen zu werden.
Paul hatte zu seinen Cousins und zu seiner Cousine wenig Kontakt. Er war zu niedrig gestellt, um für voll genommen zu werden. Paul war nur der arme Verwandte! Ja, wenn man sich zufällig traf, sprach man ein paar Worte miteinander, man stammte schließlich aus der gleichen Familie - aber mehr auch nicht.
Auch in der Nachkriegszeit hatte Gustav mit seinem Betrieb schwer zu knabbern. Es dauerte noch etliche Jahre, bis er ihn endlich zu voller Blüte brachte und seinem Ruf als guter solider Orgelbaumeister gerecht wurde. Nun kamen seine besten Jahre. Der Betrieb boomte.
Genau wie vor ihm Oskar, fand auch Paul durch eine Zeitungsannonce eine Lehrstelle beim Schmiedemeister Finster in Wellersdorf bei Sagan. Paul freute sich auf die Lehre. Im ersten Lehrjahr sollte es zu Weihnachten drei Mark Lohn geben und im zweiten Lehrjahr sechs Mark. Das schien Paul verlockend zu sein. Was es im dritten Lehrjahr geben sollte, ist nicht überliefert. Ansonsten gab es keinen Pfennig. Paul hatte Essen und Quartier im Hause des Meisters frei und das war es! Ja, Paul freute sich ehrlich, denn er konnte nicht ahnen, dass der Schmiedemeister Finster haargenau so finster war, wie sein Name. Er war ein Teufel in Menschengestalt. Außer Paul hatte Meister Finster noch zwei andere Lehrlinge. Er nahm jedes Jahr einen. Der, der ausgelernt hatte, musste gehen, weil er von nun an einen Gesellenlohn beanspruchen konnte und den bezahlte der Meister nicht. Es wurde eben ein neuer Lehrling eingestellt. Es funktionierte wie ein ewiges Karussell. Man handhabte es in allen Betrieben so, wer ausgelernt hatte, musste gehen.
Die Lehrlinge schliefen auf dem ungeheizten Dachboden auf klapprigen wurmzerfressenen Holzbetten auf alten Strohsäcken unter Decken, fast wie Pferdedecken. Es gab mehr Dresche als zu essen. Alle hungerten. Die Hauptnahrung waren Pellkartoffeln mit Salz oder Maisgrießsuppe. Nach Feierabend mussten sie Eicheln sammeln gehen, die die Frau Finster röstete, zerkleinerte und dann aus den Krümeln Kaffee kochte.
In dieser Zeit beim Meister Finster entwickelte sich Paul zum Weltmeister im Pellkartoffelpellen. So wie die Knollen dampfend auf dem Tisch lagen, fingen alle drei Jungen an zu pellen wie Verrückte nur um den knurrenden Magen einigermaßen füllen zu können. Aber Paul war ewig hungrig. Manchmal schob ihm die Frau Finster heimlich einen trockenen Brotkanten zu und flüsterte: Der Alte darf aber nichts davon wissen!“ Und Paul hütete sich, etwas zu verraten. Bei Sonnenaufgang wurde gefrühstückt - trockenes Brot und Maisgrießsuppe. Ehe er zu essen anfing, musste Paul schon 250 abgezählte handgefertigte Schmiedenägel dem Meister vorlegen.
Paul wurde vom Meister so sehr geschlagen, wenn etwas nicht klappte, dass ihm das Blut vom Kopf aus an den Beinen herunterlief. Noch in hohem Alter sah man deutlich die Narben seiner überall eingerissenen Ohren. Viermal rückte er verzweifelt aus, immer schickte ihn Karolina zum Meister zurück. Die Dresche war umso fürchterlicher. Aus dem 14jährigen Paul wurde ein kläglicher verhungerter Dreckspatz. Nicht einmal richtig waschen konnte er sich bei der schmutzigen Arbeit. Es gab keine Seife - es war Krieg - nur parfümierte Tonseife. Die fühlte sich zwar glitschig wie Seife an, säuberte aber nicht. Wenn Paul wenigstens am Wochenende warmes Wasser haben wollte, warf er ein Stück glühendes Eisen in einen Eimer mit kaltem Wasser. Im Nu heizte es sich auf.
Paul hatte neben seiner Lehre auch noch Feldarbeit zu leisten. Als er eines Tages vom Feld aus in die Schmiede trat, war der Meister gerade dabei ein Pferd zu beschlagen. Da sprang ein Stück glühendes Eisen von 2 cm im Quadrat ab und Paul oben ins offene Hemd. Es rutschte über Pauls Brust den Bauch entlang, glitt an einem Bein hinab, bis in die alten abgelegten, ausgelatschten Stiefel vom Meister, die Paul trug. Paul brüllte wie ein geschundenes Tier und fiel in Bewusstlosigkeit, ehe die anderen begriffen, was sich abgespielt hatte und ehe sie ihm endlich den qualmenden Stiefel vom Bein zogen. Sein ganzes vorderes Wadenbein war eine große schwarze bis auf den Knochen verbrannte Wunde.
Es war ein Sonnabend, an dem das alles geschah. Einer der seltenen Sonnabende, an dem Paul nach Benau zu seiner Mutter fahren durfte. Und das tat er auch! Mit seiner schweren Verletzung begab er sich elend und schutzsuchend auf den Weg nach Hause. Bis Sorau reicht sein Geld. Die restlichen Kilometer nach Benau musste er dann laufen. Was das bedeutete, kann jeder nachempfinden. Auf halber Strecke ließ ihm ein Bauer aus Benau auf seinen Ochsenwagen steigen, nahm ihn mit und schleppte ihn dann zu Karoline ins Haus. Karoline schlug die Hände entsetzt über dem Kopf zusammen, als sie Pauls Bein aus den dreckigen Lumpen wickelte und schickte sofort jemanden nach Grabig, der ihren Bruder Paul holen sollte. Paul hatte sich vieles von seinem verstorbenen Vater angenommen und verstand sich etwas auf Heilkunst. Ob es nun richtig war oder nicht, Paul erzählte mir, sie hätten sein Bein mit Leinöl geheilt. Aber es dauerte - Paul war lange krank. Und als er endlich wieder einigermaßen gesund wirkte - schickte Karoline ihn zurück zum Meister Finster nach Wellersdorf.
In der Zeit als Paul am Ende seines zweiten Lehrjahres stand, überfiel den Meister wieder ein fürchterlicher Tobsuchtsanfall. Er ging mit dem Löschspieß, der zum Feuern gebraucht wird, auf Paul los und verletzte ihn so schwer, dass ihm wieder das Blut bis in die Stiefel lief. Da endlich erwachte Paul. Blutüberströmt und in seiner Schmiede-Lederschürze fuhr er auf der Stelle auf das Obervormundschaftsgericht nach Sorau. Pauls Aussehen überzeugte die gerade anwesenden Richter auf der Stelle. Er brauchte nicht mehr zu dem finsteren Meister zurück. Man brachte ihn für sein letztes Lehrjahr in einem Heim unter, in dem sich Paul sehr wohl und glücklich fühlte. Sein Bruder Oskar hatte ausgelernt und musste, wie es üblich war, gehen.
Er fand in Christianstadt eine Anstellung und zog zu Paul in das Heim. So gut hatten es die beiden Brüder noch nie gehabt, und sie wuchsen in diesem Jahr so richtig innig zusammen. Dem Schmiedemeister Finster in Wellersdorf wurde für immer die Erlaubnis, Lehrlinge auszubilden, entzogen. Paul bekam für sein letztes Lehrjahr eine Stelle in Christianstadt beim Schmiedemeister Finke zugewiesen. Finke nahm Paul sehr gerne und sie kamen auch blendend miteinander aus. Am 6. April 1920 legte Paul seine Prüfung mit „gut“ vor dem Gesellenprüfungsausschuss ab. Elf Tage später erreichte Paul sein siebzehntes Lebensjahr.
Sofort nach dem Ende des 1. Weltkrieges fand Karoline, wieder durch eine Annonce, einen neuen Schmiedemeister für ihre Schmiede. Die Männer, die den Krieg überlebt hatten, kehrten heim und suchten Arbeit. Also hatte Karoline nunmehr Glück bei ihrer Suche nach einem geeigneten Angestellten, der ihre Schmiede weiter betreiben konnte.
Es war Adolf Wolski aus Witten an der Ruhr, ein gelernter Hufschmied. Im Krieg war er Oberfahnenschmied gewesen und wollte es nun in Benau versuchen. Er gab sich die allergrößte Mühe, aber es wollte nicht so richtig klappen. Die Benauer waren ein eigenartiges und etwas eigensinniges Völkchen und ignorierten ihn einfach. Sie lehnten ihn ab und taten, als gäbe es ihn nicht - gingen in eine andere Schmiede, wenn sie die Dienste eines Schmiedemeisters in Anspruch nehmen mussten. Vielleicht wollten sie ihn nicht, weil er ein Fremder war. Und dann auch noch aus der Stadt, so einen konnten sie sowieso nicht leiden. Alles was fremd war, wurde vorsichtshalber erstmal kaltgestellt.
In der Zwischenzeit waren Karoline und Adolf Wolski ein Paar geworden und heirateten. Alle Kinder waren aus dem Haus. Auch Marta hatte die Schule hinter sich und arbeitete als Hausmädchen.
Und als die Benauer nicht aufhörten, ihren Adolf zu boykottieren, verließ Karoline Benau für immer. Sie vermietete Haus und Schmiede und folgte mit Marta ihrem Mann nach Witten an der Ruhr in die Pferdebachstrasse 3. Adolfs Brüder hatten dort eine Schmiede gemietet; aber Adolf arbeitete in einer Kohlenzeche als Grubenschmied. Nach 1929 verkaufte Karoline ihren Besitz in Benau und erwarb dafür in Witten die Schmiede und das Wohnhaus. Sie erfüllte sich einen lang gehegten Wunsch und richtete sich im Wohnhaus einen Tabakwarenladen ein. Aus der Benauer Schmiede machten die neuen Besitzer eine Bäckerei. Paul und Oskar, beide noch nicht volljährig, folgten Karoline nach Witten und nahmen dort Arbeit an. Paul schuftete schwer als Feuerschmied beim Kesselbau. Aber langsam verbesserte sich Pauls Leben. Er hatte seine Arbeit und endlich Geld in der Tasche. Und natürlich trug er jetzt auch eigene Lederschuhe und nicht mehr die abgelegten Klamotten von Oskar.
Paul wurde viel selbständiger und wollte noch viel lernen und erleben. Zuerst lernte Paul das Boxen. Er hatte gehört, dass der Boxsport das Selbstwertgefühl unerhört steigern und das Training den ganzen Körper stärken würde. Als dann aber seine Nase gebrochen und schief im Gesicht saß, fand er Boxen nicht mehr so ideal und ließ davon ab. Er versuchte sich als Ringkämpfer - na ja - mit mäßigem Erfolg. Überall, wo Paul lebte, fand er Freunde. Aber sein liebster, bester Freund blieb sein Bruder Oskar. Ihre gemeinsame Schwester Anna hatte nach Dahme/Mark geheiratet; einen Otto Möbuss, der Teilhaber eines gut florierenden Geschäftes war. Er handelte mit landwirtschaftlichen Maschinen und führte Reparaturen an Traktoren und Motoren in eigener Werkstatt aus. Das Geschäft stimmte. Bald gehörte es Otto Möbuss allein. Anna hatte sich gut verheiratet - wie man so schön sagte.
Paul und Oskar zogen in Kost und Logis nach Dahme und arbeiteten als Monteure für Otto Möbuss. Für Paul wurde es eine seiner wichtigsten Aufgaben. Er lernte alle Arten von landwirtschaftlichen Maschinen aufs Beste zu reparieren, auch Automotoren. Eigentlich war für ihn die Zeit in Dahme seine allerwichtigste Lehre. Eine die prägend für sein ganzes Berufsleben werden sollte. Aber erst traf ihn ein furchtbarer Schlag. Oskar starb an Typhus. Es war ein schrecklicher Schmerz für Paul und er trauerte eigentlich lebenslang um seinen Bruder. Er vermisste seinen Vertrauten immer und überall. Beide waren erst Anfang 20, als Oskar gehen musste.
Paul blieb etliche Jahre in Dahme und lernte und lernte. Nebenbei machte er die Führerscheine 1, 2 und 3. Dann kamen Pauls glücklichste Jahre. Er fuhr auf einem Motorrad für die Firma Krupp in Essen als Außenmonteur für Landmaschinen durch alle Ostgebiete Deutschlands von einem Gut zum anderen. Überall erwartete man ihn dringendst. Während der Erntezeit war er ein so notwendig gefragter Mann, dass er, wenn er mal pullern musste, sich keine Zeit nahm, seine Maschine anzuhalten und abzusteigen, sondern es während der Fahrt erledigte. Zum ersten Mal in seinem Leben war er frei - frei - frei. Er war ein echter Cowboy der Landstraße. Endlich erfüllte ihn echtes einfaches Glück und sein Leben gefiel ihm so wie es war. Er brauchte keine Träume mehr. Vorläufig jedenfalls nicht; denn sie hatten sich erfüllt. Paul war nun 24 Jahre alt.
Der Orgelbauer Gustav Heinze erholte sich mit seinem Geschäft erst so richtig einige Jahre nach dem Krieg. Er hatte große Einbußen erlitten; aber dann stieg er auf wie nie zuvor und baute eine Orgel nach der anderen. Viele haben die Zeit bis heute überlebt und erklingen noch heute im ganzen ehemaligen Schlesien, in der Niederlausitz, in der Mark Brandenburg und sogar in Berlin. Gustav wurde so etwas wie ein reicher Mann.
1920 baute er für die evangelische Stadtkirche in Forst/Niederlausitz eine prachtvolle Orgel mit 62 klingenden Stimmen. Der Forster Mittelschullehrer Hermann Standke, der eine Chronik der Niederlausitz verfasste, schrieb, dass diese Orgel der schönste, aber auch der teuerste Schmuck der Stadtkirche wäre. Er schwärmte von der Orgel und schrieb, sie hätte 1302 Pfeifen, die größte sei 4,80 m hoch und die kleinste maß nur 6 mm. Die Orgel kostete 200 000 Mark, die durch freiwillige Spenden zusammengetragen worden sind.
Es begab sich zu dieser Zeit, dass eine Familie Adolf Gerst in Forst in der Sorauer Strasse 5 lebte und der Gemeinde der Stadtkirche angehörte. Noch zu den eher bescheidenen Klängen der vorherigen Orgel - 1909 war die Tochter der Familie Berta Meta Charlotte, in der Stadtkirche eingesegnet worden. Nun genoss die Familie die brausenden Klänge der neuen Orgel - hauptsächlich die Weihnachtskonzerte. Adolf Gerst hatte sein Geld verloren und seine Berta Meta Charlotte, die ich der Einfachheit wegen nur Meta nenne, musste arbeiten gehen. Ihre Ehe mit dem Architekten Jurtz war in die Brüche gegangen. Und nach etlichen Irrwegen landete sie mit ihrem Töchterchen Gisela auf dem großen Gut bei Grabig als Herrschaftsköchin. Sie betonte immer die Bezeichnung Herrschaftsköchin und legte größten Wert darauf, nicht etwa als einfache Köchin abgestempelt zu werden, denn sie war die Herrschaftsköchin des Gutes.
Im Frühling oder Frühsommer 1927 war Kirmes in Grabig und es wurde tüchtig das Tanzbein geschwungen. Meta tanzte vergnügt mit dem Gutsherrn. Da kam Paul auf seinem Motorrad angeknattert. Er ahnte nicht, dass Meta ihn schon entdeckt hatte und sein Absteigen aus den Augenwinkeln heraus beobachtete. Paul kam zur Tanzfläche geschlendert, um mal zu prüfen, wie groß das Mädchenangebot so war. Und plötzlich tauchten seine Augen in Metas veilchenblaue Blicke und auf der Stelle verliebten sie sich ineinander. Von nun an tanzte Meta nur noch mit Paul. Der Gutsherr konnte und wollte es gar nicht glauben, so kaltgestellt zu werden und umrundete mit bösen Blicken die Tanzfläche. Meta hatte nur noch Augen für Paul und Paul für Meta.
Nur wenige Tage später bekam Meta die Quittung. Sie wurde entlassen. Wie nahe sich Paul und Meta schon gekommen waren, vermag ich nicht zu sagen. Meta flüchtete mit Gisela, wie so oft, wenn sie nicht mehr weiter wusste ins Elternhaus nach Forst. Und nun hörte sie ganz gewiss bei den sonntäglichen Andachten die Musik, die die neue Heinz-Orgel hervorzauberte. Paul fuhr weiter auf seinem Motorrad durch die Lande, um Landmaschinen zu reparieren. Zwischendurch bewohnte er aber immer das Wohnhaus neben der Benauer Schmiede.
Es muss wohl zu dieser Zeit nicht vermietet gewesen sein und verkauft hatte es Karoline auch noch nicht. Er blieb in Verbindung zu Meta und ich glaube, sie haben sich auch gegenseitig besucht. Briefe zu schreiben, war für Paul ein Problem. Er war nicht sehr geübt im Liebesbriefe schreiben. Da riet ihm ein hilfreicher Kumpel zu einem Liebesbriefsteller. Paul war begeistert, genierte sich aber sehr, so ein Buch zu kaufen und lief erstmal an dem Buchladen vorbei - und dann noch einmal - bis er sich endlich hineintraute. Als er es dann hatte, kam ihm alles Geschriebene doch zu schwülstig vor; aber einige Sätze fand er doch gut und verwendete sie in einem Brief an Meta. Dieser Brief ist erhalten geblieben; er ist eingefügt und man erkennt sofort, dass das nicht Pauls Worte sein konnten.
Na - jedenfalls holte sich Paul seine Meta und die kleine Gisela nach Benau. Von nun an wurde Meta begeisterte Motorradmitfahrerin und saß hinter Paul auf dem Sozius, und es gab für sie nichts Schöneres als übers Land zu fahren.
Für damalige Zeiten war das etwas frivol - fanden die Benauer jedenfalls. Sie beäugten Meta misstrauisch und beschlossen, sie nicht leiden zu können. Irgendwie ist das schon verständlich. Meta hatte eine uneheliche Tochter, die kleine Eva, die in Forst bei den Großeltern aufwuchs. Sie war eine geschiedene Frau mit Kind, sie kam aus der Stadt und dann war sie zu allem Überfluss auch noch 8 Jahre älter als Paul. Vielleicht war Meta, klein und hübsch, wie sie damals war, ein wenig hochnäsig und stolzierte in zu hübschen Kleidern durchs Dorf.
In Grabig dagegen schätzte man sie sehr und Paul Neumann war ihr Vertrauter. In Grabig wusste man von ihren hauswirtschaftlichen Kenntnissen. Den Benauern waren die schnurz piepe.
Ihre größte Gegnerin war ihre angehende Schwiegermutter Karoline. Die beiden schienen sich richtig zu hassen. Karoline glaubte wohl auch, Meta nage am Hungertuche, denn eines schönen Tages kam aus Witten ein Paket von Karoline für Meta. Als sie es öffnete, enthielt es alte abgelegte Kleider. Meta bekam einen echten Wutanfall und sah das Paket als Beleidigung an. Ganz Benau war verblüfft, als Meta ihre Möbel, die in einem Speicher eingelagert waren, kommen ließ und das Haus neu möblierte. Langsam erkannte man sie an. Aber zwischen Meta und Karoline blieb die Feindschaft ihr Leben lang bestehen und beide betrieben und pflegten sie eifrig.
Am 31. Mai 1928 heirateten Paul und Meta. Der Polterabend wurde ein übermütiges rauschendes Fest, denn Paul hatte einen Sack voll lustiger lauter Freunde. Sie hatten sich ein ganzes Pferdefuhrwerk voll altem Porzellan besorgt und kippten die ganze Ladung knallend vors Haus. Es wurde so lange gefeiert, bis kein Tropfen Alkohol mehr im Haus war - aber heim wollte immer noch niemand gehen. Da mixte Meta einen Trunk zusammen, der aus allen Flüssigkeiten wie Kaffee, Himbeersaft und einer ganzen Pulle Baldriantinktur bestand - aber keinen Alkohol enthielt. Er schmeckte allen köstlich - keiner merkte etwas.
Weil alle Burschen so freche Sprüche losgelassen hatten, rächte sich Meta, indem sie im Schlafzimmer eine Woche die Gardinen nicht aufzog.
Die Zeiten verschlechterten sich. Die Firma Krupp in Essen, für die Paul arbeitete, stellte in den Ostgebieten die Außenmontage ein. Als Paul sich von dem Schock erholt hatte und wieder zu sich kam, beriet er die Lage mit zwei pfiffigen Kumpeln, die er schon aus Essen kannte. Sie fällten eine kluge Entscheidung. Sie ließen sich in eine neue Kruppfiliale nach Berlin versetzen, die in Berlin Friedrichsfeld-Ost auf dem Magerviehhof eingerichtet worden war. Es war ein Maschinen- und Ersatzteillager für Berlin und Umland. Alle drei wurden als Monteure eingestellt und knatterten von nun an durch die Mark Brandenburg. Ihr Hauptgedanke bei der Umstellung war aber noch ein anderer gewesen. Sie befürchteten eine drohende ums ich greifende Arbeitslosigkeit und sie hofften, wenn es für sie soweit war, in Berlin eher eine neue Stelle zu finden als auf dem Land. Wie Recht sie behalten sollten, konnten sie noch nicht wissen.
Die Drei mieteten zusammen auf dem Gelände des Magerviehhofs eine leer stehende Bürobaracke und teilten sie in drei Wohnungen auf. So konnte jeder von ihnen Frau und Kinder nachkommen lassen.
An jedem Wochenende knatterte Paul nach Hause, nach Benau zu Meta und Gisela. Meta konnte im Moment nicht umziehen. Die Anstrengung wäre zu groß gewesen. Meta war hochschwanger. Paul lebte nur noch in Aufregung, konnte die Geburt seines ersten Kindes kaum erwarten. Dann kam endlich der 18.8.1929 heran. Es war ein Sonntag voller Sonne wie selten. Paul war zu Hause. Mit hochrotem Kopf rannte er wie ein Verrückter los, als Meta zu ihm sagte, er müsse nun die Hebamme holen. Nachmittags um 14.00 Uhr wurde in dem Haus, in dem schon Paul geboren wurde, im gleichen Zimmer ein kleines Mädchen geboren. Und das kleine Mädchen war ich. Meta war meine Mutter und Paul war mein Vater. Ich wurde die große Liebe seines Lebens. Man taufte mich in der Benauer Kirche auf den Namen Rosemarie Christiane Heinze. Als ich acht Wochen alt war, verließen meine Eltern mit mir unser Heimatdorf und wir wurden Berliner. Etliche Jahre später legte Paul seine Prüfung zum Maschinenmeister für Kühlanlagen ab.