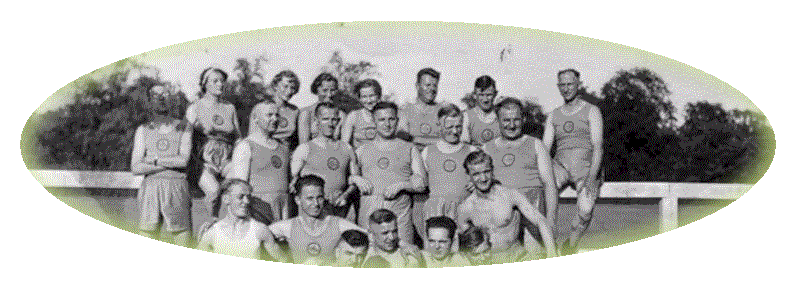
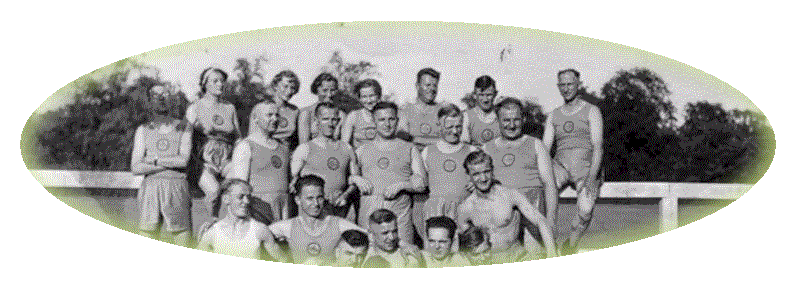
Die andere Seite des Triftweges (1938)
Uns Kinder aus der Kriegerheimsiedlung erreichten die Vorboten des 2.Weltkrieges schon Anfang 1938, als man uns unser Indianerland wegnahm. Unsere Jagdgründe und Kriegspfade befanden sich auf der großen Wiese am Triftweg, neben und hinter dem alten kleinen Wasserwerk, das heute noch steht, bis hin zum Upstallweg. Da gab es Gräben, Hügel und Kuten, Wiesenblumen und Birkengebüsch, daß es eine Lust war, dort zu spielen. Gleich danach klaute man uns die Sportplätze an der Treskowallee, die ungefähr dem Bärenschaufenster gegenüber lagen. Der Eingang und die Umkleideräume befanden sich im Upstallweg. Eine Riesenbuddelei begann, die schon Kriegsvorbereitungen waren. Auf unser Indianergebiet und auf die Sportplätze baute man eine großflächige Militäranlage, auf der später eine schwere Flakstellung mit großen Scheinwerfern stationiert wurde. Wir Kinder lungerten dort herum und beobachteten den Aufbau und den Einzug der Soldaten. Dann verscheuchte man uns meistens.
Fast zur gleichen Zeit fing man an, auf der anderen Seite des Triftweges, haargenau da, wo sich heute an der Bahn entlang, Wirtschaftsgebäude des Tierparks befinden, ein Barackenlager zu errichten. Nun beobachteten wir Kinder da den Aufbau und ahnten nichts Böses. Warum auch. Fremde Männer zogen ein. Stille Männer. Das Lachen, Singen und Pfeifen aus den Soldatenquartieren fehlte vollkommen.
Dann brach der Krieg aus. Begeisterung erfüllte mich. Endlich würde mal was los sein. Wir würden es den anderen schon zeigen. Hauptsächlich unserem Erbfeind - dem Franzosen.
Ich war gerade 10 Jahre alt und endlich - endlich bei den Jungmädchen aufgenommen. Die Uniform wollte ich am liebsten gar nicht mehr ausziehen. Unsere Heimabende fanden immer im Kant-Gymnasium (heute Hochschule) statt, gleich hinter den ersten drei Fenstern links neben dem Eingang oder in dem kleinen runden Turmzimmer. Auf dem Hof lernten wir exerzieren und marschieren. Mit Begeisterung marschierte ich durch Karlshorst die Treskowallee entlang. Zackig-zackig - den Kopf hoch, in schöner strammer Haltung, die Augen geradeaus, ein frohes Lied auf den Lippen - unser Wimpel flatterte voran. Aus voller Kehle sang ich: "Ein junges Volk steht auf zum Sturm bereit, reißt die Fahnen höher Kameraden. Wir fühlen nahe unsere Zeit, die Zeit der jungen Soldaten!" Etwas später brüllte ich lauthals: "Bomben, Bomben! Bomben auf Engeland." Mir war ja auch bis dahin noch keine aufs Dach gefallen. Jedenfalls - ich war durchdrungen von Vaterlandsliebe und Treue zum Führer. Der würde es schon machen. Einmal, unverhofft, marschierte ich in Karlshorst an meinen Eltern vorbei. Die blieben stehen und starrten mir sprachlos nach. Ich fand mich prima.
Zwischendurch hielten wir wie immer am Barackenlager auf der anderen Seite des Triftweges Maulaffen feil. Da wurde es für uns immer interessanter. Der Eingang stand nun unter schwerer Bewachung. Richtig mit echten Gewehren. Das imponierte uns. Die Insassen verließen es nur noch in Arbeitstrupps. Es waren Männer aller Altersklassen, darunter ganz junge Burschen. Ihre Kleidung bestand aus scheinbar wahllos zusammengestellten Hosen und Jacken in Zivil. Sie sprachen eine andere Sprache und sahen anders aus als unsere Brüder und Väter. Ihre Kopfform und ihre Gestalt ordnete ich sofort zur ostischen Rasse. O - wir Kinder wußten Bescheid. Neuerdings hatten wir Rassenkunde. Man brachte uns bei, daß die germanische Rasse die Herrenrasse darstellte und das mit der ostischen nicht viel los war. Diese Menschen waren faul, falsch, ohne Kultur und hinterlistig.
Mich überkamen immer ganz leise Zweifel bei dieser Lehre, denn meine Busenfreundin Margot, die ich heiß liebte, gehörte mit ihrem breiten Gesicht einwandfrei zu einer ostischen Rasse - doch sie konnte besser rechnen als ich. Sie war eben eine löbliche Ausnahme, redete ich mir ein und niemals hätte ich auf sie etwas kommen lassen. Höchste Befriedigung erfüllte mich, weil ich ganz klar zur germanischen Rasse gehörte. Man hatte sogar meinen Kopf gemessen. Wenn wir Rassenkunde hatten, mußte ich immer zur Ansicht nach vorne vor die Klasse treten, als Vertreterin der arischgermanischen Rasse. Einmal sogar vor versammelter Lehrer- und Schülermannschaft in der Aula des Kant-Gymnasiums. Ich hätte in den Bretterboden der Bühne sinken mögen vor Peinlichkeit. Mein vermessener Kopf glühte puterrot - aber stolz war ich doch.
Als meine Eltern dahinter kamen, daß ich mich oft an diesem Lager herumdrückte, wurden sie sehr böse und hielten mir eine mächtige Standpauke. Sie verboten mir, mich jemals wieder an diesem Lager herumzutreiben und mich niemals mehr am Unglück anderer Leute zu weiden. Ich war tief erschrocken. Wahrhaftig - das wollte ich nicht. Ich ging nie wieder über die Treskowallee auf die andere Seite des Triftweges.
Trotzdem sah ich etliche Männer, die in dem Lager wohnten, bald wieder. Nämlich beim Bunkerbau auf unserer Seite des Triftweges. Ganz kurz vor der Fleischfabrik auf einer Wiese und fast genau gegenüber auf der anderen Straßenseite, baute man für die Bevölkerung zwei große Flachbunker. Für den zweiten holzte man einen kleinen Kiefernwald ab, aber er kuschelte sich doch noch an ein Akazienwäldchen. Das war ein Gebaue, Gewühle und Gekrame, daß wir Kinder voll auf unsere Kosten kamen.
Der allergrößte Teil der Bauarbeiter bestand aus sogenannten Ostarbeitern, streng bewacht von Deutschen mit Gewehren. Zwischen den armseligen, nicht gut genährten Ostarbeitern und den Anwohnern, durfte es keinen Kontakt geben. Dafür sorgten die Aufseher. Heimlich, wenn sie sich einen Augenblick unbeobachtet glaubten, zeigten uns die Ostarbeiter durch Gesten, daß sie Hunger hatten oder gerne eine Zigarette rauchen möchten. Meine Mutter warnte mich: "Wenn du ihnen jemals etwas gibst, landen wir alle selbst in diesem Lager, denn irgend jemand wird es sehen und Dich verpetzen."
Eine einzige Frau setzte sich über dieses Verbot hinweg. Wir nannten sie alle nur die dicke Müllern. Sie wohnte in unserem Häuserblock im dritten Eingang parterre rechts in der Giebelwohnung. Sie hatte drei Mädchen: Inge, Jutta und Sisi, die alle meine Freundinnen waren. Sisi wohnt noch heute in der Kriegerheimsiedlung, die nun Splanemannsiedlung heißt.
Der Mann der dicken Müllern war ein höheres Tier bei der Kriminalpolizei. Gerade darum war es besonders gefährlich, was diese herzensgute Frau tat. Ich beobachtete mehrmals, wie sie vom Einkauf schwere Taschen schleppend, vor dem Bunkerbau stehen blieb, absetzte und verschnaufte. Dann bückte sie sich, nestelte ächzend an ihrem Schuh - richtete sich stöhnend wegen ihrer Körperfülle wieder auf, griff nach ihren Taschen und ging langsam gemessenen Schrittes nach Hause. Immer lag dann im Rinnstein ein Päckchen, das verdächtig nach von Zeitungspapier umschlungenen Stullen aussah. Es dauerte meistens nur Sekunden und ein Ostarbeiter schnappte sich das Geschenk des Himmels.
Noch heute möchte ich mich vor der dicken Müllern ehrfurchtsvoll verneigen. Es war wahnsinnig gefährlich was sie tat. Ich habe nichts in den Rinnstein gelegt, aber gottlob, sie wenigstens nicht verraten. Ich komme ins sinnieren. Die dicke Müllern ist lange tot und die Kinder erfahren vielleicht erst durch diese Erzählung, was sie für eine tapfere Mutter hatten.
Da Deutschland gleich am Anfang des Krieges gegen Frankreich kämpfte, dauerte es nicht lange und die ersten Kriegsgefangenen trafen ein. In die Sedina-Fleischwarenfabrik kamen etwa 40 Mann in festes Quartier; einen Bewacher gab es nicht. Ich sah jedenfalls nie einen. Die 40 Mann lebten eigentlich ganz prima. Ganz anders als die Ostarbeiter. Sie standen gut im Futter, sangen, waren vergnügt und konnten sich auf dem Gelände der Fabrik frei bewegen. Ich war zuerst etwas irritiert, daß sie für meinen Vater, der in der Fabrik Maschinenmeister war, ganz normale Arbeitskollegen darstellten, die zwar französisch sprachen, aber für ihn ganz so menschlich waren, wie wir selber. Er sah sie nicht als Feinde an. Wo war denn nun bloß der Erbfeind?
Emil Krüger, der Besitzer der Fleischwarenfabrik, war weder ein Franzosenhasser noch sonst ein Hasser - aber ein Kinofan. Er besorgte einen Vorführapparat und Filme in silbernen Blechdosen und von nun an, gab's jeden Dienstag, am Abend im Speisesaal, für die Franzosen eine Kinovorstellung. Es liefen keine großartigen Filme durch den surrenden Kasten, aber die Männer amüsierten sich - und ich auch. Ich glaube, jeden Charly Chaplin-Film, den ich kenne, habe ich im Speisesaal mit den Franzosen damals gesehen.
Ich kannte die Fabrik In- und auswendig, denn jeden Abend machte mein Vater noch einen Rundgang und kontrollierte die Kühlanlagen. Wir wohnten direkt nebenan und er nahm mich sehr oft mit. Auf diese Art wurde ich mit den Franzosen immer vertrauter, kannte bald alle, wenn auch nicht namentlich und machte, wenn ich sie begrüßte, artig einen Knicks, wie sich das für ein wohlerzogenes kleines Mädchen gehörte. Sie bauten für mein etwas ramponiertes Puppenhaus wunderschöne neue Möbel und luden mich zu Ihren Weihnachtsfeiern ein und beschenkten mich mit Blockschokolade, Datteln und Feigen. Ich durfte an ihren Veranstaltungen teilnehmen und bekam einen Ehrenplatz ganz vorne an der Bühne in der Mitte, damit ich die Aufführung auch gut sehen konnte.
Dann bauten sie für unseren Luftschutzkeller einen robusten Schrank, der einen Puff vertragen konnte. Auf wunderbare Weise hat er all die Jahre überlebt, ist sogar nach dem Krieg, auseinander genommen, in tiefer Nacht, heimlich mit der S-Bahn nach dem Westen übergewechselt und steht nun in unserem Keller in Spandau.
Zu einem Franzosen der Franz hieß, entwickelte mein Vater ein besonderes kameradschaftliches Verhältnis. Franz stammte aus Oran in Französisch-Marokko und erzählte schwärmerisch von seiner schönen Heimat. Eins stand fest! Wenn der Krieg aus war, würden wir Franz in Marokko besuchen!
Bei einem Bombenangriff im August 1942, als ein Teil der Fabrik in Trümmer fiel, halfen die Franzosen die verschüttete Frau Sattler auszugraben; leider verstarb sie an den Verletzungen. Keiner der Franzosen wagte einen Ausbruchsversuch, dabei stand das große Tor den ganzen Tag offen. Die Fabrik stellte ihre Burg dar, die ihnen Schutz gab. Für mich gab es keinen Erbfeind mehr.
Das Lager auf der anderen Seite des Triftweges veränderte sich. Die Arbeitstrupps verließen nicht nur im Morgengrauen das Gelände, sondern auch zu der Zeit, in der ich in die Schule mußte. Und abends marschierten sie zurück durch Karlshorst, wenn es noch taghell war. In ihren schweren Holzschuhen, deren Klang heute noch in meinen Ohren liegt, zogen sie in die Wuhlheide, verloren sich da und kehrten abends, todmüde vom Schuften, auf der Treskowallee zurück. Hin und her - jeden Tag zur Ansicht. Ich erinnere mich, daß die ersten Trupps lange dunkle grüne Militärmäntel trugen.
Plötzlich veränderte sich das Aussehen dieser Trupps aufs Neue. Die Männer wurden immer dünner, immer grauer, immer gebückter, immer schwächer, immer kränklicher - bis sie schließlich, nach erschreckend kurzer Zeit, nur noch wandelnden Elendsgestalten glichen. Entsetzen packte mich, wenn ich sie sah. Aber ich mußte sie sehen. Eine Mitschülerin aus meiner eigenen Klasse, fing an, heimlich hinter vorgehaltener Hand und unter dem Versprechen der Verschwiegenheit, Monstergeschichten über das Lager zu erzählen. Sie wohnte auf einem Laubengelände noch hinter dem Lager. Ihr Weg führte sie also immer daran vorbei. Sie erzählte von Beobachtungen ihres Vaters, von lauten Schreien in der Nacht, von schlimmen Prügelszenen und von einem Galgen, an dem im Morgengrauen ein Mann gehangen hätte. Ich hielt das für Spinnerei, für ein Gespenstermärchen, denn wir machten gerade unsere Geisterphase durch, erzählten uns in den Pausen und Bunkernächten Spukgeschichten. Aber ein unheimlicher Gedanke blieb zurück.
Auf einmal nahm mein Vater mich nicht mehr mit zu den Franzosen. Vielleicht lag es an den vorwitzig sprießenden Brüstchen? Vielleicht an der ersten heiß erkämpften Dauerwelle?
Meistens traf ich mit dem Häftlingstrupp an der Bahnunterführung Ecke Triftweg, Treskowallee zusammen. Eine Litfa▀säule stand an dieser Ecke. Alles war noch viel enger, denn die Brücke wurde erst viele Jahre später verbreitert. Wenn wir nun gemeinsam durch die Unterführung liefen, war ich fast nur auf Armeslänge von der Kolonne entfernt. Wehe man hätte ein Zeichen gegeben oder etwas zugesteckt. Das war bei der scharfen Bewachung unmöglich.
Die armen Menschen ähnelten nun lebenden Leichnamen, waren Skeletten gleich. Zogen sie zur Arbeit aus - liefen noch drei nebeneinander. Wenn sie wiederkamen, schleppten oft zwei den dritten in der Mitte auf einer selbst gemachten Bahre aus Birkenästen und alten zerlumpten Decken oder Mänteln. Der Zusammengebrochene lag immer da wie tot und wird es wohl auch oft gewesen sein. Manchmal schleppten zwei den dritten in der Mitte mit den Armen gestützt und umschlungen. Die schweren Schuhe schlurften auf dem Pflaster. Mühsam stolpernd schwenkte der Zug um die Ecke in den Triftweg; angetrieben durch Schreie und Tritte.
Eines Tages traf mich, wie ein Blitz, ein Augenpaar. Ich erstarrte. Diese Augen in den dunklen eingesunkenen Höhlen kannte ich doch. Aus dem Mund des Kopfes, der zu den Augen gehörte, kam kein Laut - aber der verzweifelte Blick, der sich an meinem festsaugte, schrie verzweifelt: "Siehst du mich, erkennst du mich, siehst du mein Elend, wirst du erzählen wo ich geblieben bin?" Ich starrte fassungslos zurück. Dann war der Zug vorüber gezogen.
In meinem Hirn machte etwas klick - und ich konnte wieder denken - und dann machte es noch einen Knips und die Lampe ging aus, die mir den verdammten Krieg in rosarotem Licht gezeigt hatte. Von nun an konnte mir der Endsieg gestohlen bleiben. Wenn ich ihn manchmal doch noch etwas herbeiwünschte, dann nur deswegen, weil ich die Rache unserer Feinde fürchtete. Die traf mich 1945 als ich 15 Jahre alt war.
Diese Augen! Diese Augen! Die kannte ich gut. Sie gehörten dem jüngsten der französischen Kriegsgefangenen aus der Fabrik. Diese verhungerte, ausgemergelte Kreatur war einmal der blonde hübsche lebensfrohe Gefährte der Kinoabende im Speisesaal gewesen. Ich stürzte nach Hause um meinen Eltern das soeben Erlebte zu berichten. Sie schienen ratlos zu sein. Natürlich folgte erstmal das berühmte: "Sag bloß zu keinem Menschen einen Ton - halte den Mund!" Aber mein Vater ging sofort rüber in die Fabrik um die Neuigkeit vorsichtig weiterzugeben. Wahrscheinlich fühlte er sich mir gegenüber doch verpflichtet, etwas zu dem Geschehen zu sagen und so erklärte er mir folgendes. Natürlich erst nachdem ich feierlich gelobte, mit keiner Menschenseele darüber zu reden. Der junge Franzose hatte sich in eine deutsche junge Arbeiterin in der Fabrik verliebt und sie sich in ihn. Man hatte sie eng umschlungen überrascht. Der junge Mann war auf der Stelle abgeholt worden, irgend jemand hatte sie angeschwärzt. Das war das ganze Verbrechen! Das war der Grund für diese unmenschliche Strafe für dieses wohl tödliche Drama.
Was mag aus dem jungen Franzosen geworden sein? Ich sah ihn nie wieder in einem Arbeitstrupp. Ob er überlebt hat? Seine Augen verfolgen mich noch heute nach über 50 Jahren. Sein Blick hat sich unauslöschlich in meiner Seele fest gebrannt. Er hat mir nie Ruhe gelassen, weil er mir bis ins Herz gedrungen ist. Vielleicht ist er umgekommen. Vielleicht hat ihn seine Familie schon vergessen. In mir lebt sein Blick weiter.
Nachforschungen über ihn haben nichts ergeben. Alle Lagerunterlagen hat man vor der Kapitulation vernichtet. Bei uns in der Bevölkerung hatte das Lager jahrelang überhaupt keinen Namen. Sehr spät im Krieg, sprach man, wenn überhaupt, nur vom KZ. Eigentlich sprach man so gut wie nie über das Lager. Man schwieg es einfach tot, weil man es fast nicht ertragen konnte, es in der nächsten Nachbarschaft zu wissen. Es lag quasi vor der Haustür - nur auf der anderen Seite des Triftweges. Es ist schon ein seltsam Ding! Kein Karlshorster, den ich gefragt habe, will von dem Lager gewusst haben. Offiziell hieß es Arbeits- und Erziehungslager Wuhlheide. Aber es war wie ein Konzentrationslager.
Im Winter 1943-44, den ich in Forst in der Lausitz verbrachte, erzählte mir mein Vater während eines Besuches, daß alle französischen Kriegsgefangenen überraschend aus der Fabrik abgezogen worden sind. Als Ersatz kamen italienische Gefangene.
Einer der Franzosen soll später französischer Stadtkommandant von Berlin geworden sein. Ob es stimmt weiß ich nicht. Aber eins weiß ich genau! Meine Geschichte war kein böser Traum, denn der Schrank der Franzosen steht in unserem Keller.