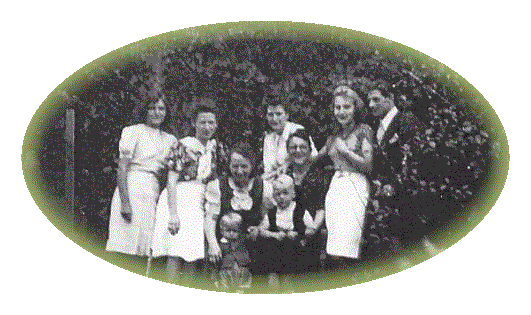
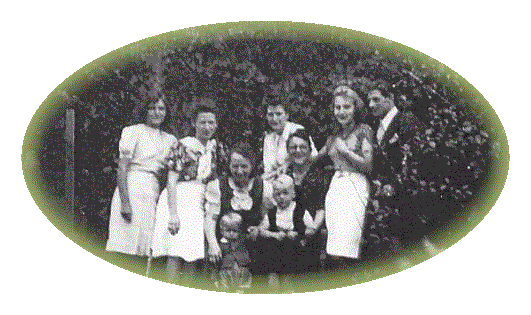
Die Vertreibung aus der Kindheit
von
Rosemarie Erdmann
Emma starb genau zur richtigen Zeit!
Was dann folgte im Frühjahr 1945, das hätte sie
in ihrem hohen Alter nicht mehr gepackt. Sie hätte es gar nicht mehr
verstanden. Das Chaos, in dem sie gezwungenermaßen hätte leben müssen, hätte
ihre Kräfte überschritten. Es war gut so, dass ihr das alles erspart blieb.
Emma Gerst, geborene Stieglitz, die wir alle nur
Omama nannten, war unsere Großmutter mütterlicherseits. Sie lebte schon viele
Jahre in ihrem Haus in Forst, in der Sorauerstraße 5. Neun Kinder und den Mann
hatte sie längst verloren. Nur meine Mutter Meta war ihr noch geblieben. Aber
die Stütze und die Freude ihres Alters fand sie in meiner ältesten Schwester
Eva und deren kleinen, fast einjährigen Söhnchen Hans Jürgen, die bei ihr
lebten. Omama hatte Evchen liebevoll von klein auf großgezogen. Sie blieben
auch zusammen in der großen Wohnung, als Evchen ihren Erich heiratete und der
Junge geboren wurde. Erich konnte den Kleinen nur ein einziges Mal sehen, dann
fiel er dem damals sogenannten Heldentod in Italien in die Arme. Die beiden
Frauen, die Alte und die Junge brauchten sich mehr denn je und halfen sich
gegenseitig.
Zwei Zimmer der großen Wohnung hatten Herr und
Frau Till mit ihrem Kater angemietet. Herr Till war manchmal, nur ganz kurz, auf
Urlaub von der Front zu Hause, denn er musste ja, wie fast alle Männer, unser
deutsches Vaterland verteidigen. Mit Frau Till lebte Omama schon jahrelang im
Clinch. Omama clinchte gerne. In der Wohnung über Omama, in der ersten Etage,
lebten Tante Hedi mit ihrer Tochter Ilse und deren Kindern Peter und Gabi. Mit
denen allen lebte Omama auch im ewigen Clinch. Tante Hedi war die Frau von
Omamas verstorbenen ältesten Sohn Wilhelm. Die zwei oberen Etagen bewohnten
fremde Leute.
Hinter dem Haus lag ein kleiner Garten der ganz nahe an die Bahngleise herangrenzte. Die Züge rollten nach Sorau, Sagan und weiter an die Ostfront. Forst in der Lausitz lag Anfang Januar 1945 in fast beschaulicher Ruhe – unbombardiert in der Landschaft. Doch die Ruhe war trügerisch – unter ihr grummelte es gefährlich. Man ging zwar seiner Arbeit oder seinen Geschäften nach, doch es wurde zunehmend unbehaglicher. Spannung erfüllte die Forster Luft. Langsam rückte der Russe immer näher an die Stadt. Jeder hoffte auf eine rechtzeitige Kapitulation der Deutschen Wehrmacht, hütete sich aber, es laut auszusprechen, denn das hätte tödlich sein können. Vielleicht steckten manche den Kopf auch etwas in den Sand. Das Wort Flucht war ja noch nicht gefallen. An so eine Katastrophe glaubte noch kein Mensch – wollte auch gar nicht daran denken. Alle sehnten herbei, dass der Russe gestoppt wird – irgendwie jedenfalls, wie wusste keiner. Man würde ihn doch auf keinen Fall ins Reich lassen! Entweder würde es eine neue große siegreiche Offensive der Deutschen geben – oder eine rechtzeitige Kapitulation. Also wartete man ab – wenn auch etwas unruhig.
Noch fuhr die kleine, dampfgetriebene
Industriebahn, von allen Forstern liebevoll Schwarze Jule genannt, durch die
Stadt. Immerhin gab es ein Schienennetz von 24 Kilometern, dass die vielen
Tuchfabriken untereinander und auch mit dem Bahnhof verband. Es war ein
Ereignis, wenn sie schmauchend, stinkend, ratternd und warnend pfeifend durch
die Straßen zockelte. Groß und Klein liebte die Schwarze Jule – ich auch.
Aber zurück zu Omama. Sie stand im 87. Lebensjahr, kurz vor ihrem Geburtstag. Vollkommen unbewusst wählte sie die Stunde ihres Todes genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Vorboten, die sich am Tage vorher einstellten, erkante niemand. Sie fühlte sich einfach nur unwohl und legte sich hin. Frau Till, mit der Evchen sprach, borgte ihr einen Toilettenstuhl, damit sich Omama nicht über den langen ungeheizten Flur ins Bad quälen musste. Es war Winter und bitterkalt. Als Evchen ihr am nächsten Morgen auf diesen Stuhl helfen wollte und Omama im Bett half, sich aufzurichten, machte diese auf einmal ganz erschrocken große Augen. Evchen ließ sie zurückgleiten und legte sie wieder hin. Omama sagte keinen Ton. Als Evchen ihr später etwas zu Trinken einflößen wollte, bemerkte sie, dass Omama Schluckprobleme hatte. Evchen sprach beruhigend auf sie ein und wischte ihr den auftretenden Schweiß von der Stirn. Omama sah sie dankbar an. Gesprochen hat sie kein Wort mehr.
Evchen rannte ins Nebenhaus zu Dr. Radlof, der schon über viele Jahre unsere Familie behandelte. Er kam auch sofort zu der Kranken, aber er untersuchte Omama überhaupt nicht. Dr.Radlof stand am Fußende von Omamas Bett und sie sahen sich beide still an. Dann nickte er ihr nur stumm zu – Omama verstand genau, was er ihr dadurch sagen wollte.
Draußen, vor der Tür von Omamas Zimmer, nahm er Evchen in die Arme und ging. Jeder wusste nun, dass der Tod im Haus war.
Evchen rannte sofort zu Ziegers rüber, dem Lebensmittelladen an der Ecke schräg rüber, um bei uns in Berlin anzurufen. Das war nicht so einfach wie heutzutage. Für einfache Sterbliche wie uns, gab es damals noch kein Telefon. Das konnte sich bei uns in der Splanemann- Siedlung kaum jemand leisten. Wenn Evchen uns etwas Wichtiges mitzuteilen hatte, rief sie bei Thiemanns an. Thiemanns wohnten in unserer Straße, die Triftweg hieß, vier Aufgänge weiter und hatten außerdem einen kleinen Kolonialwarenladen auf der anderen Straßenseite, uns ziemlich gegenüber neben dem alten Wasserwerk in dem heute Lidl residiert. Den kleinen Laden konnte man eigentlich nur eine Bude nennen. In dem hinteren angebauten Schuppen stand seit Jahren unser Traumauto hochgebockt. Das Telefon stand aber in der Wohnung. Hatte Evchen bei Thiemanns jemanden erreicht, kam der wie der Sausewind zu uns gerannt, um Bescheid zu sagen, und von uns raste sofort jemand zu Thiemanns rüber, um zu hören, was es Neues gab. Der Aufwand sieht von heutiger Warte beträchtlich aus – aber damals war dieses Telefonieren üblich.
Dann setzte Evchen sich zusammen mit Frau Till an
das Bett von Omama und erzählten leise, um beruhigend auf die Kranke zu wirken.
Auf einmal sagte Frau Till: »Jetzt ist sie gerade gestorben!« Ja – Omama war
tot!
Viel Zeit blieb Evchen nicht um andächtig zu trauern, vielleicht ein paar Minuten, als sie am Abend total erschöpft ins Bett fiel. Alle Behördengänge mussten nun erledigt werden.
Zuerst kam die Leichenwäscherin, die wollte, dass die Leiche sofort im Sarg abgeholt werden sollte, aber Evchen weigerte sich, sie wollte Omama nicht herausgeben, bis unsere Mutter sie noch einmal gesehen hatte. Es wurde ihr dann erlaubt, wenn die Tote ganz allein in einem Zimmer ruhen konnte. Das war ja möglich. Am Ende nahm die Leichenwäscherin noch heimlich Omamas Trauring und alle Wäsche mit.
Am nächsten Tag kam unsere Mutter angereist um Evchen zu unterstützen, sich hauptsächlich um den kleinen Hans Jürgen zu kümmern. Bevor das Chaos über Forst hereinbrach, konnte unsere Omama in größtmöglichster Ruhe noch in Forst auf dem Friedhof beigesetzt werden. Nach der Trauerfeier verbrannte man ihren Leichnam und die Urne mit ihrer Asche grub man in die Urnenstelle ihres Sohnes Walter und dessen Frau Frieda, ein.
So fand sie noch in Forst ihre ewige Ruhe und es blieb ihr viel erspart, was ihr unsägliche Qualen bereitet hätte.
Zwei Tage, nach dem meine Mutter Forst wieder verlassen hatte, stand mein Vater unverhofft vor Evchens Tür. Er hatte es sehr eilig, wollte sofort mit dem nächsten Zug wieder nach Berlin zurück. Er rechnete damit, jeden Moment zum Volkssturm eingezogen zu werden – und davor konnte man sich nicht drücken. Wenn er nicht da sein würde, hätte das schreckliche Konsequenzen für ihn gehabt. Befehl war Befehl. Er hatte nur die Absicht, zwei Koffer voller Wäsche wieder nach Berlin zu holen, die wir in Forst vor den Bombenangriffen sicher deponiert hatten. Es sah nämlich langsam so aus, als würde man sie eher in Forst als in Berlin verlieren. Evchen wurde recht nachdenklich.
Ende Januar erweckte ein unheimliches Geräusch, dass von der Straße kam, ihre Aufmerksamkeit. Sie spähte durch die Ritzen der Jalousien und erschrak zutiefst. Sie sah den ersten Flüchtlingstreck ihres Lebens durch die Sorauer Straße ziehen. Es war so unheimlich, weil er sich leise wie ein Geisterzug vorwärtsschob. Kein menschlicher Laut war zu hören, nur das leise Getrappel vieler Ochsenhufe. Seltsamerweise gab es in diesem Treck keine eingespannten Pferde – nur Ochsen – und weil deren Hufe nicht beschlagen waren, hörte sich ihr Tritt so sanft an. Ab und zu quietsche ein Rad – knarrte eine Achse oder eine Deichsel unter der Belastung. Die Fuhrwerke waren hochbepackt mit Betten und Säcken zwischen denen manchmal Kinder, alte Leute oder zu Tode erschöpfte Kranke hockten. Dick eingemummelt, denn es herrschte ein strenger Winter. Manchmal saß der Gespannführer auch mit obenauf, aber meistens lief er nebenher um die Last, die die Tiere ziehen mussten, etwas zu erleichtern. Der Treck musste vom Forster Stadtteil Berge über die Neiße gekommen sein. Sicher aus Schlesien.
Evchen starrte auf den Treck, als bestehe er aus Gespenstern. So war das also, dachte sie. So sieht es aus, wenn man seine Heimat, Haus und Hof verlassen muss.
Von nun an wurde alles anders.
Jetzt begann die Angst vor der Zukunft. Die Hoffnung auf eine rechtzeitige Kapitulation konnte man wohl aufgeben. Die Furcht vor den Russen saß so tief in jedem, denn aus der Gerüchteküche hörte man jeden Tag von neuen Grausamkeiten. Noch gab es keinen Aufruf, dass Frauen und Kinder die Stadt verlassen sollten. Man wusste, dass der Russe gefährlich näher kam. Evchen fing an zu packen. Dann am 14.Februar wurde bekannt gegeben, dass für Frauen mit Kindern Züge auf dem Bahnhof bereitstanden um sie in Sicherheit zu bringen.
Hedi und Ilse kamen zu Evchen runter, um mit ihr zu beraten, was man tun sollte. Sollte man vielleicht doch lieber bleiben und abwarten? Es ist schwer, sein schönes Heim nur mit dem was man selber tragen kann, zu verlassen. Ganz entschlossen sagte Evchen: »Ich gehe weg!« »Gut« antworteten Hedi und Ilse »dann kommen wir mit – wir gehen gemeinsam!«
Vorsorglich hatte Ilse für jeden eine Stofftasche mit Reißverschluss genäht, die man sich umhängen konnte und so die wichtigsten Papiere bei sich direkt am Körper tragen konnte.
Jede der drei Frauen nahm so schweres Gepäck wie sie nur schleppen konnte und jede ein Kind. Los ging’s zum Bahnhof, Richtung Cottbus-Berlin.
Forst machte absolut noch keinen chaotischen Eindruck. Die meisten Bewohner schienen die Aufforderung, die Stadt zu verlassen, zu ignorieren. Man hörte ja noch gar kein Grollen der Kanonen von einer näherrückenden Front – also wartete man erst mal ab. Eventuell gab es doch noch eine rechtzeitige Kapitulation.
Auf dem nahegelegen Bahnhof brauchten die drei Frauen keine Fahrkarten zu lösen. Der Beamte sagte: gehen sie nur durch, der Zug steht bereit. Es war ein normaler Personenzug mit normalen Abteilen, den gelben Holzbänken der damaligen Zeit. Der Zug stand und stand, Stunde um Stunde – aber er füllte sich nicht. Evchen fragte den Beamten, ob sie noch einmal kurz nach Hause laufen könnte, um für die Kinder zu trinken zu holen. Ja, er gestattete es.
Als Evchen ins Haus trat, kam ihr Herr Till entgegen, der auf Sonderurlaub war. Er rief fassungslos: »Was haben Sie denn gemacht – Sie haben ja Ihren Wohnungsschlüssel stecken lassen!« »Ja«, antwortete Evchen »mit voller Absicht: Wenn jemand klauen will, braucht er nicht auch noch das Türschloss kaputt zu machen!« Herr Till schüttelte nur den Kopf. Evchen rannte zum Zug zurück. Wieder wartete man ewig auf die Abfahrt. Auf dem Nebengleis, Zug an Zug stand nun ein Truppentransport der Deutschen Wehrmacht. Da gab’s Spaß und Abwechslung. Langsam fing man an, die Gegend um Forst mit Soldaten voll zu stopfen. Dann wollten die Soldaten Rotwein. Brot gegen Rotwein! Evchen fiel ein, dass sie im Keller Rotwein liegen hatte und dachte, besser die Soldaten saufen ihn als die Russen! Sie rannte zum Gaudium aller los und holte ihn. – Endlich - nach qualvollen Wartestunden setzte sich der Zug in Bewegung. Es wurde angesagt, wegen einer schweren Schlacht könne der Zug nur über Jüterbog nach Nauen fahren. Nun gut – Nauen war nicht weit von Berlin entfernt. Hautsache, erst mal weg aus Forst! Jetzt saß ihnen doch allen die Angst im Nacken: Wenn man dagegenhält, was andere Frauen mit ihren Kindern an Schrecklichem, Unauslöschlichem auf Flucht und Vertreibung erlebten, stellt sich Evchens Flucht aus Forst eigentlich mehr als Reise dar. Sie saßen in richtigen Coupés und die Fahrt dauerte nur bis zum Abend. Dann waren sie in Nauen.
In Nauen steckte man alle in eine ehemalige Schule, die schon von anderen Flüchtlingen vollgestopft war. Betten für jeden gab es natürlich nicht. Es war Stroh aufgehäuft, darauf konnte man sich auf Decken niederlassen um zu schlafen. Hilfe von Frauen der NSV, des Roten Kreuzes und der Frauenschaft stand überreichlich zur Verfügung. Die Nazis waren perfekte Organisatoren. Unmengen von Stullen wurden geschmiert und gut belegt. Batterien von Teekübeln stillten den Durst der Frauen, Kinder, Alten und Gebrechlichen.
Seltsamerweise erzählte meine Schwester später, dass kein Kind geschrieen oder geweint hatte. Als sehr sehr weise erwies sich Tante Hedi. Sie hatte eine große Kostbarkeit im Gepäck, die die momentane Situation unerhört erleichterte: Einen Nachttopf für die Kinder! Eins von den drei Kleinen, die sie mithatten, saß fast immer drauf, und sei es auch nur, um einmal in Ruhe und am Daumen nuckelnd, die ungewohnte Umgebung nachdenklich zu betrachten. Das Windelproblem schien fast unlösbar. Pampers gab es noch nicht – die weichen Mulltücher in die man die Kinder wickelte, waren im Nu klitschenass. Wo aber ausspülen und trocknen? Viele Kinder waren wund und ewig erkältet durch die nassen Umschläge. So viele Windeln wie gebraucht wurden, besaß keine Mutter.
Über Thiemanns Telefon erreichte uns Evchen und schilderte ihre Lage. Im Nu saßen mein Vater und ich in der S-Bahn um die ganze Bande zu uns zu holen.
Wir kamen sogar ohne Schwierigkeiten hin und zurück. Das war gar nicht so einfach und selbstverständlich, wie es sich anhört. Zuerst einmal gelang es uns ohne Fliegeralarm durchzukommen. Man suchte nicht gern fremde Keller auf, denn das war gefährlich. Im Falle eines Bombentreffers – und man wurde verschüttet, suchte keiner nach einem – und die Angehörigen erfuhren nie, wo man geblieben war. Man kam eben einfach nicht mehr nach Haue – blieb verschollen.
Zweitens funktionierte an diesem Tag die S-Bahnstrecke nach Nauen. Das klappte längst nicht immer so. Durch die täglichen Bombenangriffe auf Berlin, wurden auch immer Gleise des Bahnnetzes zerstört. Oft an vielen Stellen überall im Stadtbezirk verteilt. Es grenzte an ein Wunder, wie schnell man alles reparierte – oft über Nacht.
Ein Heer von Arbeitern schuftete wie besessen, um den Verkehr wieder herzustellen. Da sah man die Organisation Todt, das Technische Hilfswerk, Hitlerjungen und Flakhelfer – aber hauptsächlich Häftlinge und Fremdarbeiter vieler Ländern. Sie arbeiteten auch während der Fliegeralarme und neuerlicher Bombenschäden, denn ihnen verbot man, einen Schutzraum aufzusuchen.
Die arbeitende Bevölkerung, die wegen einer Störung
der Strecke nicht zu ihrer Arbeitsstelle gelangte, blieb nicht etwa gemütlich
zu Hause und freute sich, einmal Ruhe zu haben – keineswegs. Jeder hatte die
Pflicht pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen. Fernbleiben wurde sehr streng
bestraft, galt als Zersetzung der Wehrkraft, Spionage und Aufruhr. Man riskierte
Kopf und Kragen, wenn man nicht zur Arbeit erschien. Also musste man laufen,
wenn man nicht fahren konnte. Jeden Tag wanderten Ströme von Menschen durch die
zerstörte Stadt hin und her. Manchmal sich mühsam den Weg durch neue Trümmer
bahnend, ein Tuch vor Mund und Nase gepresst wegen des beißenden schwarzen
Qualms. Wir hatten also Glück gehabt.
Meine Mutter brauchte entschieden größere Kochtöpfe, denn wir bildeten eine ganz schöne Mannschaft. Alles musste organisiert werden. Es gelang, meine Tante Hedi, Ilse und die beiden Kinder Peter und Gabi bei einer befreundeten Familie in einem Zimmer in unserer Splanemann- Siedlung unterzubringen. Mit Küchenbenutzung natürlich. Mein Vater verstand es, über unseren Bunkerwart, ich glaube, er hieß Ostermeier, Schlafplätze für meine Schwester Evchen und den kleinen Hans Jürgen zu ergattern. Dort übernachtete auch schon meine andere Schwester Gisela, die schwanger war und ihr kleiner dreijähriger Peter. Deren Wohnung in der Seestraße hatten Bomben zerstört und sie lebte bei uns mit ihren wenigen Habseligkeiten. Sie mussten sich abends zeitig im Bunker in ihren Schlafkabinen einfinden und sie morgens wieder zeitig verlassen. Weil aber nachts oft mehrere Fliegeralarme die Menschen aus den Betten rissen, war es für meine Schwestern und die Kinder eine Riesenerleichterung, liegen bleiben zu können.
Für mich kam diese Gnade nicht in Frage – ich
war mit 15 Jahren zu alt dafür. Tagsüber erfüllte nun ganz schönes Gekrabbel
unsere 2½ Zimmer- Wohnung. Mein Vater hatte nun, wenn ich mich selbst schon zu
den Frauen zählte, vier Frauen, zwei Kinder und sich selbst zu versorgen. Es
klappte alles prima, wenn es auch ein Riesendurcheinander war. Die
Bombenangriffe häuften sich und oft mussten wir auch tagsüber mehrmals in den
Bunker rennen. Immer schwerer und schwerer wurden die Bombenangriffe auf den
Osten Berlins, in dem wir wohnten. Man konnte manches Mal fast verzweifeln und
aus dem Dreck kam man gar nicht mehr raus – aus den Klamotten auch nicht.
Es dauerte nicht lange und meine Cousine Magda kam, um ihre Mutter Hedi, Ilse und die Kinder aus dem Zimmer unserer befreundeten Familie abzuholen und mit in den vornehmeren Berliner Westen zu nehmen. Den beiden Frauen war alles zu poplig und einfach gewesen. Sie waren an große, hohe Zimmer gewöhnt – und die hatte Magda besorgen können. Unsere Freunde freuten sich, ihr popliges Zimmer wieder selbst nutzen zu können und wir freuten uns auch, dass die ewig Meckernden verschwanden. So freuten sich alle – aber die Verbindung riss nicht ab.
So bekamen wir eines Tages von Magda eine Karte, auf der stand, dass sie uns am Sonntag besuchen will. Da schönes trockenes Winterwetter rauslockte, beschloss ich, sie von der 69 er Straßenbahn abzuholen. Sie fuhr immer bis zum Kantgymnasium. Warum wusste kein Mensch, denn unsere Haltestelle am Triftweg lag viel näher an unserer Wohnung als die am Gymnasium. Vielleicht scheute sie sich durch das kleine Akazienwäldchen zu gehen. Nun gut – ich postierte mich also gerade rüber vom Gymnasium, denn Magda kam von Karlshorst.
Es war kälter als ich gedacht hatte. Der Wind
pfiff mir um die Ohren und durchdrang meinen Mantel. Ich fror erbärmlich –
Magda ließ auf sich warten. Ich steckte die Hände in die Manteltaschen. Die
Nase in Richtung Karlshorst. Mit mir warteten auch noch andere Leute. Plötzlich
wurde ich aufmerksam. Es näherte sich ein Trupp Uniformierter auf der Fahrbahn,
wenn ich mich richtig erinnere, könnten es braune Uniformen gewesen sein. Sie
trugen eine große Hakenkreuzfahne, sie sangen aber nicht – kamen schweigend
anmarschiert. Neben ihnen auf dem Bürgersteig lief begleitend eine Gruppe Männer
in Zivil, in langen Mänteln und Schlapphüten. Gelassen sah ich zu, denn es war
ja ein alltäglicher Anblick. Aber
plötzlich wusste ich nicht mehr wie mir geschah. Zwei der Zivilisten stürzten
bösartig auf mich zu, rissen mir die Hände aus den Taschen und brüllten mich
an: »Kannst du nicht die Fahne grüßen?« Einer riss mir meinen rechten Arm
hoch, dass er fast aus dem Gelenk sprang – dann ließen sie von mir ab. Mit
ihren anderen Schlapphut-Kameraden machten sie sich nun über die Männer her,
die mit mir an der Haltstelle gewartet hatten. Sie verprügelten sie solange,
bis sie im Straßendreck lagen. Wie ein böser Spuk zogen die Marschierenden mit
der Fahne vorbei, die wir nun alle mühsam krampfhaft grüßten. Die Schlapphut-
Prügeler ließen von uns ab und liefen wieder neben dem Zug her – neue Opfer
suchend. Wir Wartenden an der Haltestelle blieben bedeppert zurück und ich half
den Männern, ihre Sachen abzuklopfen und die Hüte und Mützen zusammen zu
suchen. Einem blutete schrecklich die Nase. Der Sonntag war mir versaut.
Forst ließ uns nicht los. Jeden Tag verfolgten wir die Nachrichten im Radio um den Frontverlauf zu erfahren. Entweder man verschwieg, dass die Russen schon in Forst waren, oder sie standen wirklich noch jenseits der Neiße. Wie es sich im Radio anhörte, stagnierte dort die Front.
Evchen und ich beschlossen, wieder nach Forst zu fahren und noch Kleidungsstücke, Wäsche und Lebensmittel zu holen. Noch heute ist mir rätselhaft, wie unsere Eltern das erlauben konnten. Ilse kam mit. Trotz der heutigen Aussagen von Zeitzeugen, dass man Berlin nicht mehr verlassen durfte, bekamen wir anstandslos in Schöneweide unsere Fahrkarten ausgehändigt. Aber nur bis Cottbus. Nach Forst fuhr kein Zug mehr. Uns störte das nicht – wir wollten uns durchschlagen.
Natürlich fuhren wir nicht im D-Zug – es gab nur noch Bummelzüge und auch nicht mehr exakt nach Fahrplan. Die Coupés platzten fast aus den Fugen. So überfüllt lief endlich unser schwarzes Ungetüm aus dem Schöneweider Bahnhof. An einen Sitzplatz war nicht zu denken. Wenn jemandem entweder vor Hunger oder vor Übermüdung schwach wurde, räumte jeder mal anstandshalber eine Weile seinen Sitzplatz. Später bürgerte sich bereitwillig Abwechselei ein. Wir alle litten ja durch die dauernden gestörten Nächte an Übermüdung. Stullen hatte uns unsere Mutter mitgegeben, verhungern sollten wir so schnell nicht. Irgendwo im Frontgebiet hielt unser Zug. Wer nach Forst wollte, musste aussteigen, über ein Feld und durch Gebüsch in einen Unterstand deutscher Soldaten rennen, um sich eine Erlaubnis geben zu lassen. Das war natürlich Blödsinn, aber wir mussten den Wisch für die Weiterfahrt haben; also holten wir ihn. In Cottbus endete die Fahrt. Nun standen wir da und wussten nicht, wie wir nach Forst gelangen konnten. Dann entdeckten wir einen Truppentransport der voll geladen an die vorderste Linie fuhr – nach Forst! Wir liefen hin und überredeten die Soldaten uns mitzunehmen. Es dauerte gar nicht lange und ab ging’s an die Front – wir mittenmang. Na, das war unter den Soldaten ein ganz lustiges Leben. Sie sangen und soffen – und einer schoss sogar an die Decke des Waggons. Als in Forst ausgeladen wurde, verkrümelten wir uns heimlich und schlichen in unser Haus. Sorauer Str. 5 ist nicht weit weg vom Bahnhof. Die Straßen lagen ruhig wie im tiefsten Frieden, waren aber von Zivilisten geräumt. Ab und zu sah man doch einige rumschleichen. Soldaten gab es reichlich. Wir sprachen zwei an und baten sie, mit in unsere Wohnung zu gehen und sie nach eventuellen Plünderern zu untersuchen. Sie taten es gerne. Evchen fand die Wohnung so vor, wie sie sie verlassen hatten. Im ganzen Haus war außer uns kein einziger Mensch mehr. Wir packten reichlich, was wir mitnehmen wollten, futterten kräftig aus den kostbaren eingeweckten Obstgläsern, schliefen unruhig und brachen wie Packesel am nächsten Morgen auf und pilgerten zum Bahnhof.
Wieder war das Glück uns hold und wir erwischten einen Zug, der nach Cottbus fuhr und dort fanden wir einen Zug nach Berlin. Überglücklich empfing man uns. Und weil das alles so wunderbar geklappt hatte, beschlossen wir, 2 Tage später wieder nach Forst zu fahren. Das war der 21.Februar.
Dieses Mal wollte Ilse nicht mehr mit, sondern Tante Riemer, eine Schulfreundin unserer Mutter aus Forst. Eine Tochter vom Fleischermeister Menzel, der sehr oft Schützenkönig in glücklichen Zeiten in Forst gewesen ist; - Wieder bekamen wir anstandslos unsere Fahrkarten bis Cottbus. Je näher wir Cottbus kamen, um so öfter und länger pausierte unser Zug auf freier Strecke. Einmal hieß es Tiefflieger – aber sie verschonten uns. Endlich in Cottbus angelangt – konnten wir keinen Truppentransport, der uns mitnahm, aufgabeln. Nach aussichtslosen Versuchen und Beratungen, stellten wir uns an eine Landstraße, die nach Forst führte und versuchten, Wehrmachtsfahrzeuge anzuhalten. Bei einem Laster mit Plane hatten wir Glück. Die Soldaten versteckten uns und noch ein paar andere – und los ging’s in wackeliger Fahrt, denn wir mussten stehen. In Forst, an unserer Ecke Sorauer- Berliner Straße, am Cafe Viktoria schmissen sie uns raus. Aber ein Soldat mit schussbereitem Gewehr begleitete uns auch dieses Mal ins Haus, um unsere Wohnung zu kontrollieren wie bei unserer ersten Fahrt. Dieses Mal trafen wir die Wohnung nicht mehr unversehrt an. Die Schlösser waren aufgebrochen und die Schränke durchwühlt. Ich weiß nicht mehr genau, was alles fehlte – aber auf alle Fälle die Arbeitsgeräte meines Schwagers Erich, der Damenfriseur war. Irgendwie schien uns die ganze Atmosphäre in der Stadt anders. Das Brodeln der Front schien in allernächster Nähe zu sein. Wir hatten nicht einen Zivilisten rumlaufen sehen. Der Soldat hatte uns gesagt, die Stadt sei total geräumt worden und die Situation sei gefährlich. Es habe schon Artilleriebeschuss gegeben. Wir sollten machen, dass wir die Stadt hinter uns ließen. Am Wasserturm lagen schon tote Zivilisten. Das hörte sich ja alles gar nicht so gut an. Wir packten so schnell es ging, das zusammen, was wir mitnehmen wollten. Das war zum Beispiel ein Riesenkorb mit Aussteuerwäsche von Evchen, Koffer, Taschen und Rucksäcke. Ich selber schnallte mir einen mit einem Stoffsäckchen voll Weizengrieß auf den Buckel, was gar nicht so wahnsinnig schwer war – aber mit der Zeit mächtig belastete. Auf keinen Fall wollten wir in unserem Haus schlafen. Es war uns unheimlich so alleine. Also auf zum Bahnhof mit dem ganzen Gepäck; aber von da fuhr kein Zug mehr. Es war auch gar keiner mehr da. Aus Cottbus kam keiner und gleich an der Neiße, am Ende unserer Sorauer Straße, sollte der Russe stehen. Es war dunkel und wir fanden kein Wehrmachtsauto, das uns mitnahm. Auf dem Weg zum Bahnhof, schräg von ihm gegenüber, hatten wir ein Pappschild an der Hautür gelesen »Hier noch Zivil«. Zu diesem Haus trabten wir und bummerten an die verschlossene Tür. Hilfsbereite Leute ließen uns ein und in ihrem Keller die Nacht verbringen.
Am nächsten Morgen war guter Rat teuer. Auf alle Fälle mussten wir so schnell wie möglich raus aus Forst. Uns blieb nichts weiter übrig als zu Fuß nach Cottbus zu laufen.
Los ging’s also! O Gott – so hatten wir uns das nicht vorgestellt. Mit der Zeit schien unser Gepäck aus Blei zu bestehen. Auf einer Hauptstraße nach Cottbus ging es etwas besser. Ab und zu nahm uns ein Wehrmachtsfahrzeug ein Stück mit – aber leider nie eine lange Strecke. Ein Kradfahrer mit Beiwagen war besonders nett. Er fuhr ein paar Mal hin und her, um uns 2-3 Kilometer vorwärts zu bringen. Wir brauchten den ganzen Tag für die 35 Kilometer nach Cottbus. Wir hätten Gott auf Knien danken können, als wir abends im Dunkeln dort auf dem Bahnhof standen. Zu unserem Entsetzen sagte man uns, es fahren keine Züge mehr nach Berlin! Da – in der Not – hatte Tante Riemer den besten Einfall des Jahrhunderts. Sie machte den Vorschlag, dass wir uns zu ihrer Schwester, die in Cottbus wohnte, schleppen, da die Nacht verbringen, dann das Hauptgepäck dort stehen lassen und uns nur mit kleinem Gepäck nach Berlin schleusen – egal wie. So machten wir es und wir waren von dem Monster-Reisekorb befreit.
Also, am nächsten Tag, wieder guter Hoffnung, standen wir auf dem Bahnhof. Da passierte uns etwas, worüber wir drei fast in einen Lachkrampf fielen. Aus rätselhaften, unerfindlichen Gründen hatte sich Evchen ihren Rucksack mit einem Steintopf voll selbst eingelegter Senfgurken auf den Rücken geschnallt. In der Bahnhofsvorhalle rutschte sie aus, das Gewicht des Gurkentopfes riss sie nach hinten – und der Steintopf zerbrach. Die ganze duftende Brühe lief aus dem Rucksack über ihren Mantel und triefte vom Saum herunter. Sie versaute die ganze Bahnhofshalle – aber es war sowieso alles dreckig und voller Menschen, die rumlagen und schliefen oder unruhig hierhin oder dorthin rannten. In dem Chaos kümmerte sich kein Mensch um Pfützen von Senfgurkenbrühe. Evchen schleppte die Reste samt Scherben bis nach Hause und wir verspachtelten sie mit allerbestem Appetit.
Dann hieß es irgendwann, es würde noch ein Zug fahren, aber nicht nach Berlin, sondern nach Großbeeren. Wir freuten uns, denn Großbeeren war dicht bei Berlin und von da aus würden wir, wenn wir Glück hatten, sogar mit der S-Bahn nach Hause kommen. Als der Zug einfuhr, konnten wir ihn sogar gleich besteigen, aber es dauerte Stunden, bis er sich langsam in Bewegung setzte. Wir kamen kaum vorwärts. Hunger plagte uns. Mutters Stullen waren lange verputzt. Einmal hielt neben uns ein Truppentransport mit Soldaten. Die bettelten wir erfolgreich um Kommissbrot an. Einander mal, auf freier Strecke, als unser Zug wieder ewig rumstand, liefen wir alle zu einem kleinen Flüsschen, um uns zu waschen. Bei aller Misere hatten wir das Glück, von keinem Tiefflieger beschossen zu werden.
Nach drei Tagen saßen wir wieder in unserer 69er
Straßenbahn in Karlshorst, als es den Fliegeralarm gab, den ich an anderer
Stelle schon mal beschrieben habe. Ich riet dem Fahrer, nicht anzuhalten,
sondern bis zu unseren Bunkern im Triftweg durchzudonnern – und er hat es auch
wirklich getan.
Unsere Mutter saß ja im Bunker immer so ziemlich auf der gleichen Stelle. Wir schlängelten uns zu ihr durch. Als sie uns erblickte, brach sie vor Erleichterung in Tränen aus. Evchen, die auf einem freien Hocker niedersank, fiel augenblicklich in tiefen Schlaf. Wir waren total fix und alle.
Mein Vater behauptete aber, wir müssten so schnell wie möglich die Sachen aus Cottbus holen, denn wenn die Russen über die Neiße kommen, wisse man nicht, wie schnell sie weitergaloppieren. Wenn die einmal rennen, dann rennen sie – sagte er.
So wurde beschlossen, dass wir einen Tag ausruhen und dann auf die III. Tour gehen. Dieses Mal aber ohne mich – ich musste ja schließlich auch noch in die Schule gehen. Aber Evchen, Tante Riemer, mein Vater selber – und Palo. Palo war ein gefangener Badoglio- Italiener, der mit weiteren Kameraden nebenan in der Fleischfabrik in Gefangenschaft lebte. Er war der Arbeitsgehilfe meines Vaters, der in der Fleischfabrik Maschinenmeister war. Die Italiener lebten in sehr loser Haft. Sie hatten Ausgang – konnten sich ziemlich frei bewegen. Sie waren die Nachfolger der Franzosen, über die ich in meiner Geschichte von der anderen Seite des Triftweges erzählte.
Mein Vater holte Palo gleich zu uns rüber, wir wohnten ja gleich neben der Fabrik, um mit ihm alles zu besprechen. Bestimmt brauchte mein Vater irgendeine ausweisende Bescheinigung für Palo, wenn er ihn mitnehmen wollte.
Ich war gerade im Korridor, als die beiden kamen. Seltsam – Palo fielen fast die Augen aus den Kopf, als er mich sah und fassungslos fragte er meinen Vater: »Das ist deine Tochter?« »Ja«, antwortete mein Vater, »das ist Rosie!«
Sie fuhren im Morgengrauen los und kamen abends zurück – alles klappte
bestens.
Das Forst, das wir kannten und das zur Festung erklärt worden war, sahen wir so nie wieder. Am 22.02.1945 hatten wir Forst zu Fuß verlassen- am gleichen Tag begannen der schwere Beschuss und die Bombardierung der Stadt durch die Rote Armee.
Am 24.02. eroberten die Russen Berge, ein Stadtteil
von Forst, jenseits der Neiße – wenige 100 Meter von unserem Haus entfernt,
und der erste Großangriff mit Stalinorgeln und Brandgranaten begann. Dieses
Inferno ging pausenlos bis zum 28.02. An diesem Tag brannte auch die
evangelische Stadtkirche St. Nikolai aus und mit ihr die große herrliche Orgel
aus der Werkstatt meines Großonkels Gustav Heinze aus Sorau. Diese Orgel hatten
sich die Stadtväter einmal ein schönes Stück Geld kosten lassen. Fast acht
Wochen wurde in Forst gekämpft – erst am 18.April nahmen die Russen die Stadt
endgültig ein. Viel war nicht mehr übrig geblieben. Unser Haus hatte mit einem
einzigen Artillerie- Beschussloch ramponiert überlebt.
Später verloren wir es aber doch. Zuerst durch die Gesetze der DDR und
später durch die hohen Geldforderungen der Bundesrepublik, die wir nicht mehr
leisten konnten. Es war der reinste Betrug. Wenn das Omama wüsste!
Nach dem fast friedlichen Forst, das Evchen verlassen hatte, muss ihr
Berlin wie die riesige Anlage eines Irrenhauses vorgekommen sein – aber eines
gefährlichen Irrenhauses!
***
Teil
2
Wie schon geschrieben, musste ich noch die Schule besuchen. Meine
jetzige, nach der im Römerweg, lag in der Schlichtallee in Rummelsburg. Im
Sommer fuhr ich mit dem Fahrrad hin, im Winter mit der S-Bahn. Der Schulbetrieb
wurde immer laxer. Die sich häufenden Fliegeralarme brachten alles
durcheinander. Todesfälle von Klassenkameradinnen durch die Bombardierung verstörten
uns. Dann war wieder mal die S-Bahnstrecke demoliert usw., usw. Der Unterricht
begann wegen der Alarme, die manche Nacht 2x stundenlang dauerten, erst um 10
Uhr. Also – es war der Wurm drin.
2x in jeder Woche arbeitete ich von dieser Schule aus in einem Kindergarten und Hort in Johannisthal. Ich tat das gerne. Ich half den beiden Erzieherinnen die ganze Bande in Schach zu halten, sang und spielte mit ihnen und kam mir unerhört wichtig vor.
Bis Februar war dort mit den Fliegerangriffen alles gut ausgegangen. Johannisthal war meistens glimpflich davongekommen – aber nun häuften sich die Angriffe auf die östlichen Stadtbezirke.
An einem Tag, es könnte der 26.02. gewesen sein – aber ich weiß es nicht mehr genau, war es wieder einmal soweit. Die Sirenen jaulten nerventötend. In Windeseile halfen wir den Kindern in die Mäntel und liefen so schnell es ging mit ihnen in den in der Nähe liegenden Hochbunker. Auf der ziemlich geräumigen Treppe gelangten wir in den II. Stock und fanden dort für uns alle Sitzplätze. Die Kinder benahmen sich leise und diszipliniert. Ich weiß noch, dass ich mit den Kleinsten Fingerspiele machte: »Zehn kleine Hampelmänner zappeln hin und zappeln her – zehn kleinen Hampelmännern fällt das gar nicht schwer!« Von draußen hörte man das Ballern der Flak selbst durch die dicken Wände. Dann – plötzlich ein wahnsinniges mehrmaliges Krachen. Der Bunker schwankte und wackelte – das Licht ging aus. Von irgendwo aus der Decke oder den Wänden traten Lichtblitze hervor. Panik brach aus. Die Menschen kreischten, heulten und schluchzten vor Entsetzen. Dann sprang zur Erleichterung aller die Notbeleuchtung an. Durch Lautsprecher folgten hintereinander Aufforderungen die Ruhe zu bewahren. Es ist ja weiter nichts passiert, sagte man. Der Bunker sei nur bombardiert worden – aber das mache ihm überhaupt nichts aus – wir wären alle in größter Sicherheit. Und so war es ja auch. Die Menschen beruhigten sich – aber in mir blieb doch noch einige Zeit ein kleines Zittern. Schiss hatte man doch! Unsere Kinder hatten sich vorbildlich verhalten.
Nach der Entwarnung, als wir wieder im Kindergarten angekommen waren, er stand unversehrt – strömten viele Eltern herbei, um ihre Kinder abzuholen. Es war ein schwerer langer Großangriff gewesen. Die Straßenbahn fuhr nicht mehr. Irgendwo musste die Strecke in Richtung Karlshorst-Friedrichsfelde- Lichtenberg getroffen worden sein. Also musste ich nach Hause laufen. Es wurde ein gespenstischer Heimmarsch. Die Luft stank und war voller Rußpartikel. Über Johannisthal und Schöneweide lag Dämmerung als wolle der Abend anbrechen – doch es war erst später Mittag. In Richtung Lichtenberg und Stadtmitte schien aber schon die Nacht gekommen zu sein. Der Himmel sah rabenschwarz aus. Ich hetzte weiter und fühlte mich trotz der vielen Menschen, die wie ich durch die Straßen liefen, sehr alleine und ängstlich. Was war zu Hause los? Lebten alle noch? Stand unser Haus noch? War mein Hündchen davongekommen? Einmal kam ich nicht weiter.
Ein Haus, direkt an der Straße stand in lodernden Flammen. Löschen war zwecklos. Was sollte ich tun? Ich wollte weiter – ich wollte nach Hause! Ich nahm allen Mut zusammen und alle Kraft in den Beinen und stürmte so schnell es ging auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig an dem brennenden Haus vorbei – und gleich noch ein Stück weiter. Wie gut – denn kurz nachdem ich vorbei war, krachte ein Teil der oberen Fassade mit dem Dachstuhl herunter. Glück gehabt, dachte ich nur und rannte weiter. Zu meiner Erleichterung stand die Brücke über die Spree fest wie eh und je. Bald lief ich durch die Treskowallee. Schließlich, kurz vor meinem Ziel, am Kantgymnasium, der heutigen Hochschule, überfiel mich fast Panik. Hinter dem Bahndamm, genau da, wo unsere Splanemann- Siedlung lag (damals hieß sie noch Kriegerheimsiedlung), stiegen gewaltige Qualmwolken empor und verpesteten die ganze Gegend. Jetzt ließen sich meine Tränen nicht mehr zurückhalten, sie kullerten über mein dreckiges Gesicht. Als ich so beim Rennen war, wäre ich beinahe mit Palo zusammengestoßen. Er stand plötzlich vor mir und fing an beruhigend in seinem komischen Deutsch auf mich einzureden: »Papa, Mama – alles gut, alles gut!« Ich beruhigte mich etwas, stammelte nur ein kurzes Danke und flitzte weiter – unter der Brücke hindurch und links in den Triftweg hinein. Von weitem sah ich schon, dass Palo Recht gehabt hatte. Unser Haus stand. Überall rundherum waren frische Bombentrichter. Auch rundherum um die beiden Bunker. Es kann sein, dass an diesem Tag auch das Eisenbahnerwohnhaus und Müllers Gartenrestaurant weggefegt worden sind. Man kriegt das alles nicht mehr so genau in die Reihenfolge bei den vielen Angriffen.
Unsere Gegend ist mehrmals stark bombardiert worden. Die Bahn, die Brücke, die große Fleischfabrik, die Konserven für die Deutsche Wehrmacht herstellte – und die große Flakstellung schwerer Geschütze und starker Scheinwerfer, gaben lohnende Ziele ab. Unsere Wohnung sah aus wie immer nach schweren Angriffen. Überall Dreck und Splitter. Zwischen den Glassplittern mein verstörtes Pekinesen-Hündchen in seiner Kiste. Anklagend schielte es zu mir rüber. Ja, ja – ich knuddelte ihn, denn ich wusste, dass er getröstet und gelobt werden wollte, weil er so artig war. Er konnte zickig wie eine Filmdiva sein. Meine Mutter, meine Schwestern und die Kinder hatten im Bunker alles gut überstanden. Sie erzählten mir, dass in der Friedenshorster Straße der letzte Wohnblock der Siedlung, kurz vor der anderen Brücke, brenne. Ich glaube, er hatte vier Eingänge, bin mir aber nicht sicher. Er wurde nie wieder aufgebaut.
Da war mein Vater beim Helfen und Löschen. Ich lief auch gleich hin. Palo und mehrere seiner Kameraden waren auch da und holten Sachen aus den Wohnungen, aus denen man das noch konnte. Mein Buddelkastenfreund Wölfchen schmiss auch was möglich war, an Betten, Decken und Kleidungsstücken aus dem Fenster. Eine Feuerwehr oder eine ähnliche Hilfsorganisation gab es nicht mehr, denn Lichtenberg brannte an zu vielen Stellen.
Mein Vater hatte zwar bei der Feuerwehr angerufen
und war sogar durchgekommen, aber man sagte ihm nur: »Lieber Mann – was haben
Sie für eine Vorstellung, was in Lichtenberg los ist. – Lassen Sie es
brennen!« Und so brannte der ganze Block eben ab.
Es wurde März 1945. Meine Welt wurde immer chaotischer – aber ich wuchs so allmählich hinein, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte, wie schön und gemütlich und behütet mein Leben früher vor dieser Zeit gewesen war.
Schule fiel nun unter »ferner liefen«, fand praktisch kaum noch statt. Vom BDM aus (Bund Deutscher Mädchen), dem ich ja auch noch angehörte, musste ich eine Woche ganztägig einen Gesundheitsdienst-Kursus mitmachen. Also fuhr ich nach Köpenick, wo in einer hübschen, modernen Villa dieser Kursus abgehalten wurde. Ich lernte Verletzte in die richtige Lage zu bringen, komplizierte Verbände anzulegen, Schlagadern abzubinden, künstliche Beatmung usw.
Das alles hat mir nicht geschadet und als ich es so ziemlich begriffen hatte, kam ich zum Einsatz. Ich musste auf den Stettiner Bahnhof und der Bahnhofsmission helfen, Flüchtlinge auszuladen. Der Stettiner Bahnhof, ein so genannter Kopfbahnhof, hatte keinen Durchgangsverkehr. Die Züge, die einliefen, beendeten ihre Fahrt in ihm und fuhren von ihm aus aufs neue wieder heraus. Sein Vorplatz lag an der Ecke Bernauer- Invalidenstraße. 1945 war der reichlich 100jährige Bahnhof schon stark durch Bombenabwürfe beschädigt – aber betriebs- und fahrbereit. Es gab eine sehr gute Bahnverbindung dorthin, die ich auch benutzte. Auf meiner ersten Fahrt hatte ich ein seltsames Erlebnis. Der Zug war rappelvoll – alle Züge waren immer rappelvoll – anders kannte man das gar nicht mehr. Ich freute mich, denn ich konnte einen Sitzplatz ergattern. Plötzlich stand direkt vor mir eine alte Dame. Ich stand höflich auf, weil ich es gewohnt war, aufzustehen, wenn ein älterer Mensch stehen musste. Zu meiner Verblüffung weigerte sich die alte Dame, meinen Platz einzunehmen. Ich ließ aber nicht locker und redete ihr freundlich zu, sich doch zu setzen. Alle Leute rundherum guckten schon. Dann endlich. Mit einem hilflosen Lächeln, ratlos und als wenn ihr etwas furchtbar peinlich wäre, setzte sie sich auf meinen Platz. Und was entdeckte ich da? Sie trug einen Judenstern! Ich blieb freundlich weiterlächelnd stehen, aber etwas warm wurde mir doch in meiner BDM-Uniform. Keiner im Abteil sagte etwas – aber ungewöhnlich werden es schon alle gefunden haben. Es hätte für uns beide, für die Jüdin und auch für mich sehr unangenehm ausgehen können. Ihr war ja sogar verboten, eine Bahn zu benutzen.
Auf dem Stettiner Bahnhof herrschte heilloses Durcheinander. In jeder Ecke lagerten erschöpfte Flüchtlinge oder verwundete Soldaten. Ich meldete mich bei der Bahnhofsmission, die sich vor Problemen nicht mehr zu helfen wusste. Man teilte mir keine bestimmte Aufgaben zu – ich sollte einfach helfen wo es notwendig war – und das war in jedem Winkel. Zuerst beobachtete ich mal eine Rot-Kreuz-Helferin, was die machte und half ihr dann. Sie brachte angekommene Flüchtlinge aus dem Bahnhofsgebäude heraus und in Schutzräume. Heute finde ich niemanden mehr, der mir sagen kann, unter welchem großen Haus diese riesigen Kellergewölbe lagen. Wenn ich auf dem Vorplatz des Bahnhofs stand und zu seinem Eingang sah, lag dieses Gebäude an der linken Seite des Vorplatzes. Mir ist aber so, als wenn ich, um zum Eingang zu kommen, um das Haus herumgehen musste. Na also – unter diesem Haus in mächtigen rund geschwungenen Gewölben war eine Hilfsstation eingerichtet. Die Flüchtlinge bekamen reichlich zu essen und zu trinken. Es gab eine besondere Abteilung für Mütter mit Kindern, große Waschräume und wieder andere, in dem Stroh aufgeschüttet unter Decken lag und zum Ausruhen einlud.
Diese Hilfe schien mir die sinnvollste zu sein und die übte ich dann auch aus.
Als wieder ein Flüchtlingstransport ankam, er bestand aus Güterwaggons, half ich erst mal beim Öffnen der Türen. Was dann folgte, war entsetzlich. Die Menschen waren zum Teil schon wochenlang auf der Flucht, ehe sie diesen Zug erreichten. Manche brachen vor Erschöpfung fast zusammen, als sie ihre kleine, noch verblieben Habe aus dem Waggon zotteln wollten.
Alte total kraftlose Greise, die nicht wussten, wie
sie das Aussteigen überstehen könnten. Manche fielen mir vor Schwäche richtig
in die Arme beim Ausladen. Kinder über Kinder, still und mit großen traurigen,
vor Übermüdung roten Äuglein – viele ratlose matte Mütter, die nicht
wussten, wie alles weitergehen sollte.
Es ist mir heute unerklärlich, wie ich das gemeistert habe. Ich war ja immerhin erst 15 Jahre alt. Ich scharte immer 2 bis 3 Familien, mit Sack und Pack, Kind und Kegel um mich, und ich erklärte ihnen, dass ich sie in nahe gelegene Schutzräume bringen würde. Immer erleichterte sie diese Aussicht schon ein wenig. Dann verteilten wir das Gepäck und marschierten los. Hatte ich sie untergebracht, holte ich die nächste Gruppe vom Bahnsteig.
Einmal entdeckte ich am Rande des Bahnsteigs eine sehr alte Frau, die ganz alleine auf einem Köfferchen hockte, kraftlos den Kopf an die Wand lehnte. Als ich sie ansprach und sie fragte, ob ich ihr helfen dürfte, stöhnte sie, sie habe sehr großen Durst und nichts zu trinken. Sie wünsche sich nichts sehnlicher, als ihre Flasche mit Wasser zu füllen. Ich bat sie, an der gleichen Stelle sitzen zu bleiben und versprach, das Wasser zu holen. Ich wollte mich sehr beeilen – doch es klappte alles nicht so richtig. In den Waschräumen gab es kein Trinkwasser aus den Leitungen. Ich fand einfach keine Wasserstelle. Da fiel mir blitzartig das Bahnhofsrestaurant ein. Ich hatte es im Eingangsbereich liegen sehen. Ich also hin. Wahnsinniger Lärm empfing mich. Der Tabaksqualm wabberte über hunderte von Menschen, die dünnes Bier, rosa Brause oder Maggi-Brühe tranken. An der Theke ackerten die Zapfer wie verrückt um nachzukommen – so viele Getränke schenkten sie aus. Und dann entdeckte ich, was ich krampfhaft suchte: frisches fließendes Wasser. Es lief munter in ein Becken, in dem die Wirtin gerade Gläser spülte. Ich trat zu ihr und bat sie freundlich und höflich, mir doch die Flasche mit Wasser zu füllen. Aber das dämliche Weib lehnte glattweg ab. Sie behauptete, kein Wohltätigkeitsverein zu sein. Zuerst war ich sprachlos und dann passierte etwas, was mir noch nie passiert war. Noch nie hatte ich einen Erwachsenen frech und laut angeschrieen.
Ich brüllte, sie habe wohl vor lauter Geldverdienen keine Ahnung, was auf dem Bahnhof los sei – wenn sie mir nicht augenblicklich die Flasche fülle, werde ich mich an einer Stelle beschweren, die ihr mächtigen Ärger machen kann. Ich staune heute noch, wie schnell meine Worte wirkten. Der Mann der blöden Ziege kam dazu, flüsterte kurz mit ihr – und schon klappte es. Ich bekam sofort das Wasser.
Die alte Frau saß auf der gleichen Stelle und wartete. Für mich war es die schönste Belohnung zu sehen, wie sie ihren Durst stillte. Als sie so trank, fiel mir auf, dass sie die eine Hand, die sie in ein Tuch geschlungen hatte, nie benutzte und ich fragte sie, was mit ihrer Hand los sei. Auf mein Zureden hin, wickelte sie die Hand aus dem Tuch. Ein vollkommen vermisteter, blutiger und verjauchter Verband baumelte locker um einen Stumpf. Ihr fehlten die vier Finger der linken Hand. Der Daumen war noch da. Es konnte einen grausen bei dem Anblick der unversorgten Wunde. Tränen liefen über ihr runzliges Gesicht. Die Waggontür hatte ihr beim Zuschlagen die Finger glattweg abgeschlagen. Ich tröstete sie und versprach ihr, sie zu einer Rettungsstelle zu bringen. Ich nahm in eine Hand ihr Köfferchen, mit der anderen stützte ich die alte Frau und dann führte ich sie rüber in die ärztliche Hilfe in den unterirdischen Gewölben. Als ich mich von ihr verabschiedete, griff sie plötzlich nach meiner Hand und küsste sie. Ihr ostpreußisch verstand ich kaum, aber es war mir sehr peinlich. Und das alles in der BDM-Uniform.
Wenn dass der Hitler alles gewusst hätte.
Auf der Heimfahrt schlief ich auf dem Sitz fest ein. Plötzlich wackelt jemand vorsichtig an mir und sagt: »Mäuschen – aufwachen, wir müssen umsteigen.« Es war mein Papa, der von irgendwo kam und durch Zufall einen Platz mir gegenüber gefunden hatte.
Nach drei Tagen Bahnhofsdienst erlaubten mir meine
Eltern nicht mehr, daran teilzunehmen – und das war das Vernünftigste, was
sie tun konnten.
In der zweiten Hälfte des März, liefen wir alle noch zwischen den Fliegeralarmen, wir junges Gemüse jedenfalls, nach Karlshorst ins schöne Kapitol-Kino – einem Uraufführungshaus der UFA. Oh wie gerne ließen wir uns verzaubern von Marika Röck in dem Film »Die Frau meiner Träume«. Wie leicht und schön kam uns die Welt für 1½ Stunden vor.
Leider ergab es sich sehr oft, dass ein Alarm uns mitten aus unseren Träumen brutal herausriss. Es war schon lange keine Selbstverständlichkeit mehr, einen Film in voller Länge ansehen zu können.
Von »Reitet für Deutschland« mit Willi Birgel habe ich 3x nur das erste Drittel gesehen. Noch heute weiß ich nicht, wie er ausging.
Wenn vor dem Hauptalarm erst ein Voralarm gejault
wurde, schaffte ich es in den Bunker in den Triftweg zu rennen. Ich hatte noch
junge flinke Beine, ich schaffte es immer.
Auch noch im März, so kurz vor dem Zusammenbruch des tausendjährigen Reiches, gab es in allen noch unzerstörten Kinos »Kolberg« mit Heinrich George und Christina Söderbaum anzusehen. Vor dem Kampf um Berlin, hatte man noch schnell diesen reinen Propaganda- und Durchhaltefilm gedreht.
Dieser Film kam uns herrlich vor, uns jungen
jedenfalls. Er erfüllte uns bis obenhin mit Kriegsbegeisterung und Kampfgeist.
Natürlich hielten diese heroischen Gefühle nicht lange an. Wenn wir aus dem
Kino herauskamen und sahen unser Elend, unsere total demolierte Stadt, kehrte
die Realität zurück und das mulmige Gefühl beschlich uns wieder.
Für uns Jugendliche der damaligen Zeit spielte das Kino eine außerordentlich
große Rolle. Fernsehen und Computer gab es für uns noch nicht. Unsere Welt war
der Film. Er begeisterte uns und ließ die Debatten über die Kinoprogramme nie
ausgehen oder erlahmen. Die Schauspieler bildeten Hauptthemen unserer Gespräche,
wenn wir uns mit unseren Rädern an der Ecke Triftweg/Splanemannstraße, damals
Kriegerheimstraße, an der Telefonzelle trafen. Mit allergrößter Spannung
verfolgten wir die Programmwechsel Dienstags und Freitags. Was für ein Drama,
wenn die neu angekündigte Vorstellung nicht jugendfrei war. Es gab damals ganz
harte Bestimmungen, die auch strikt durchgesetzt wurden. Ab 16 hieß ab 16! Da
gelang selten ein Reinschummeln. Wer es dennoch schaffte, galt als Held und
konnte sich größter Anerkennung erfreuen. – In den härtesten Zeiten sangen
wir noch »Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern«, oder nach Zarah
Leander: Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn! In sehr vielen Filmen
wurde getanzt und gesungen. Wir kannten alle Schlager auswendig und sangen sie
bei jeder Gelegenheit. Man hörte sie damals an jeder Ecke. Leider ist das schon
lange verloren gegangen. Wenn damals Marika Röck ihre Schlager trällerte, trällerten
sie bald alle Berliner.
Wir Berliner hatten jetzt einen eigenen Kampfkommandanten. Er forderte pausenlos dazu auf, unsere Stadt, wie im Film »Kolberg«, bis zum letzten Mann und bis zur letzten Patrone zu verteidigen.
Nun zog man die Fünfzehnjährigen ein und die alten und kranken Männer, die noch irgendwie krauchen konnten, steckte man in den Volkssturm.
Im Kino hatte das ja alles prima gewirkt – in der
Wirklichkeit fand das keiner gut. Die wahllos zusammen gewürfelten Volkssturmmänner
sahen aus wie Elendsgestalten, blass und hohlwangig. Uniformen bekamen sie nicht
mehr, weil es keine mehr gab. Nein – mit der Garde war kein Staat zu machen
und kein Krieg zu gewinnen.
***
Teil
3
Die Aprilsonne schien auf uns nieder, als wolle sie uns trösten und uns
zeigen, wie wunderschön das Leben doch eigentlich sein könnte. Mit mir, einer
Fünfzehnjährigen, sprach natürlich keiner offen über die politische Lage.
Aber ich wusste absolut, was los war. Ich empfing meine Weisheiten durch das
Aufschnappen der Neuigkeiten aus den offenen Gesprächen meiner Eltern, unserer
vertrauten Freunde und meiner Schwestern. Man musste sehr, sehr vorsichtig sein,
sonst kam man in Teufels Küche. Eine freie Meinungsäußerung konnte tödlich
enden, wenn sie in Spitzelohren gelangte.
Ich ging nun nicht mehr in die Schule - es wurde zu gefährlich. In der
Regel gab es jetzt schon vormittags schwere Bombenangriffe. Andauernd mussten
wir in den Bunker rennen. Nachts mindestens 2x. Die Körperpflege wurde zum
Problem. Wir kamen aus unseren Klamotten kaum noch raus. Gingen wir ins Bett,
zogen wir uns an statt aus, um sofort, wenn die Sirene heulte, aufspringen zu können,
das Gepäck zu greifen, und loszurennen. Es gab keine Seife mehr zu kaufen –
kaum jedenfalls. Und die, die man irgendwo auftrieb, kleisterte und schäumte
nicht. Baden wurde fast unmöglich. Man wusste nie, ob man es ohne Alarm
schaffte, nackt in der Wanne zu sitzen. Unser Gas bestand aus so wenigen
Kubikmetern, dass man die nur selten an ein Bad verschwendete. Aber ab und zu
behauptete meine Mutter starrköpfig, wir wären wieder mal reif. Dann aber
musste eine Badewannenfüllung für uns drei reichen. Zuerst durfte ich in das
kostbare warme Nass, weil ich die verwöhnteste und verrückteste war, nach mir
badete meine Mutter – als letzter mein Vater, der war nicht so sehr
empfindlich – danach hatte die Wanne aber auch einen richtigen Dreckrand.
Eines Tages besaßen wir ein Stück Schwimmseife. Eigentlich bestand
diese Seife nur aus aufgeschlagenem erhärteten Seifenschaum. Sie fühlte sich
federleicht an. Aber wie groß war mein Entsetzen, als ich wieder mal fällig in
der Wanne saß, mich genussvoll einseifte – und plötzlich war die Seife so
gut wie weg – und dann schimpfte auch noch meine Mutter, die ja mit dieser Art
von Seife auch noch keine Erfahrung hatte. Sie war der festen Überzeugung
gewesen, die Seife würde für uns drei reichen. Ja – Pustekuchen –
Pusteseife!
Wäsche konnte man nur einmal in der Woche wechseln – es gab kaum Waschpulver. Ab und zu bettelte ich meiner Mutter eine Handvoll ab, um meine Haare zu waschen, denn Haarshampoos gab es schon ewig nicht mehr. Natürlich war das Pulver vollkommen ungeeignet, viel zu scharf und ätzend. Deo oder ähnliches kannte man überhaupt noch nicht. Wir müssen eigentlich ganz richtig unangenehm geduftet haben – aber da es allen so ging, war es eine natürliche Sache. Keinem fiel etwas auf.
Zeitungen druckte man nicht mehr – dafür gab es den »Panzerbär«. Der forderte uns pausenlos auf, Berlin zu verteidigen – wenn wir alle fest zusammenstehen, wäre der Sieg unser! Das las schon kein Mensch mehr, weil jeder wusste, was kommen würde. Aber wir suchten intensiv nach Ankündigungen von Lebensmittelsonderzuteilungen – aber die blieben aus. Ich sehnte mich so sehr nach Äpfeln. Von Apfelsinen wagte man nicht mehr zu träumen. Wir litten alle unter großem Vitaminmangel. Meine Mutter suchte nach Sonderzuteilungen von Bohnenkaffee, mein Vater nach Tabak.
Ein sich nie erschöpfendes Thema war der Vormarsch der Amerikaner. Sie standen seit Anfang März am Rhein und überquerten ihn am 06.03.45 über die Ludendorff-Brücke bei Remagen. Jeder hoffte inbrünstig, sie würden statt der Russen als erste Berlin erreichen. Zusammen mit meinem Vater verfolgte ich ganz genau den Verlauf der Ost- und der Westfront. Auf einer großen Landkarte, die im Wohnzimmer an der Wand hing, versetzten wir bei jeder Veränderung die Stecknadeln. Die Lage schien aussichtslos zu werden. Auf dem Tisch hatte die Luftlagekarte ihren festen Platz. Wenn der Flaksender die Bomberverbände über Braunschweig ankündigte, konnten wir losgehen. Aber die Ankündigungen klappten nicht mehr, denn nun kamen auch die Russen, um uns zu bombardieren – und die kamen in sehr kurzer Zeit; da musste man rennen, um in den Bunker zu kommen.
Das allgemeine Schlagwort hieß jetzt »Genieße den Krieg – denn der Frieden wird fürchterlich!«
Berlin glich einem zertrampelten Ameisenhaufen. Die vielen Flüchtlinge, die vielen Soldaten, die Ausgebombten mit ihren geretteten Bündeln, alle bevölkerten die verwüsteten Straßen. Berlin platzte fast aus allen Nähten.
Volkssturm und Arbeitskolonnen fingen an, Schützengräben auszuheben und Panzersperren zu bauen. Auch bei uns im Triftweg.
Patrouillen der Deutschen Wehrmacht kontrollierten
die Soldaten und alle anderen Männer. Wir nannten sie heimlich »Kettenhunde«,
weil sie als Erkennungszeichen ein Blechschildchen auf der Uniformbrust trugen,
das an einer Kette um den Hals hing. Immer saß ein Stahlhelm auf ihrem Kopf und
sie waren bis an die Zähne bewaffnet.
Niemals wirkten sie freundlich, niemals
nett und umgänglich – immer barsch und aggressiv. Jeder fürchtete sie, denn
sie waren Herren über Leben und Tod. Sie suchten Deserteure und fackelten nicht
lange. Wenn sie einen entdeckten, machten sie kurzen Prozess – ohne
Diskussion. Der arme Kerl wurde auf der Stelle aufgehangen – entweder an einem
Baum oder an einem Laternenpfahl. Um den Hals bekam er ein Stück Pappe gehängt,
auf dem stand: Ich war zu feige, meine Heimat zu verteidigen! Dieses Schild
mussten die Bedauernswerten oft vor ihrem Tod noch selbst schreiben. Manchmal,
wenn es eilig war, machten sie einen noch kürzeren Prozess und knallten den
Menschen einfach ab.
Oft erwischten sie ganz junge Burschen, fast noch Kinder,
in Uniformen gesteckt, um das Vaterland zu retten. Sie hatten sich heimlich von
ihrer Truppe entfernt, weil sowieso alles in Auflösung geraten war. Sie wurden
nur noch von dem einen großen Wunsch getrieben: Endlich heim zu Muttern. Der
Bevölkerung wurde es verboten, die Toten zu beerdigen. Die Leichen sollten
lange hängen oder rumliegen um andere abzuschrecken, sich auch heimlich aus dem
Staub zu machen.
Ich glaube, jeder bekam jetzt im April mächtige Angst. Zugeben
durfte man es natürlich auf keinen Fall, denn von oben kam der Befehl
zuversichtlich zu sein, denn der Sieg war unser! Das war natürlich das große Märchen
für Erwachsene der damaligen Zeit. Jeder hatte jetzt unsagbare Furcht im
Herzen. Der Untergang Deutschlands war sicher. Würden wir die Eroberung Berlins
durch die Russen überleben? Keiner konnte es sich vorstellen, dass es ein
Danach für uns geben würde. Wie eine schreckliche schwarze Wand türmte sich
das Kriegsende vor uns auf – und hinter dieser Wand gab es nichts mehr –
reineweg nichts.
Es war ein höchst eigenartiger Zustand für mich Fünfzehnjährige,
nur für eine kurze Zeit, vielleicht nur für wenige Tage, vorausdenken zu können.
Wie war das eigentlich mit dem Tod? Der Gedanke, dass er mich selber treffen könnte,
kam mir noch nicht einmal stark ins Bewusstsein. Alles passierte doch immer
irgendwie nur anderen. So schwebte ich in einem eigenartig seltsamen Zustand
durch das Chaos dieser schrecklichen Zeit.
Mit Gruseln beobachtete ich, was rundherum geschah. Aber letztendlich sagte ich mir, mir würde schon nichts passieren. Ich hatte ja meinen Papa – der würde mich vor allem Bösen beschützen!
Und es beruhigte mich kolossal, zu beobachten, wie meine Mutter eichhörnchenähnlich Vorräte hamsterte. »Für später«, sagte sie. Also, dachte ich, wird es wohl doch ein später geben. Bloß was für eins? Das war das große Rätsel.
Durch
das kleine Blättchen Panzerbär versuchte man uns einzureden, es gebe eine
Wunderwaffe; wenn die erst zum Einsatz kommt, wendet sich für uns alles zum
Guten. Dann wieder hieß es, die Wenck- Armee kommt, um Berlin zu befreien.
Vielleicht glaubten ein paar 100% Hitlertreue diesen Unfug – von uns keiner.
Woher kam eigentlich diese Riesenangst vor den Russen? Ich nehme an,
jeder wusste insgeheim, wie sich die Waffen-SS und die Wehrmacht in Russland
aufgeführt hatten – und dann die Behandlung der russischen Kriegsgefangenen
– die Ausrottung der Juden – und die Konzentrationslager und und und. Sogar
heute behaupten die meisten Alten, dass sie von diesen Lagern nichts gewusst
haben. Ich glaube ihnen das einfach nicht. Schon ich als 15jährige wusste viel.
Aber die volle Wahrheit hat uns dann doch fast erschlagen. Aber das was man
schon vorher wusste, ließ jeden sich vor der Rache der Feinde fürchten. Die
Rache der Russen war unser Schreckgespenst.
Eine meiner Freundinnen, Margot Sack, absolvierte ihr Pflichtjahr in Dahme in der Mark, weil die Arbeitsstelle ihres Vaters dorthin verlegt worden war. Jedes deutsche Mädchen musste nach der Schulzeit ein Pflichtjahr ablegen. Meistens in einer Familie mit Kindern. Margot fehlte mir sehr. Nun hatte sich die Arbeitsstelle ihres Vaters in Dahme aufgelöst und er war nach Berlin zu seiner Frau und zwei Jungen zurückgekehrt. Margot kam ihm in Dahme sicherer vor – und so ließ er sie bei der Familie, deren Kinder sie betreute. Viele kamen nun zurück aus ihren Evakuierungsorten, in die sie vor den Bombenangriffen geflüchtet waren. Nun kamen sie in die reinste Hölle. Berlin glich einem Hexenkessel und aus allen Ecken sah einen das Elend der Menschen an.
Auch mein
Buddelkastenfreund Wölfchen hatte sich längst aus seinem KLV-Lager
(Kinder-Land-Verschickung im Warthegau) nach Berlin durchgeschlagen.
Unsere Flakstellung war verlegt worden, um für den Bodenkampf eingesetzt
zu werden. Im Schlosspark stationierte sich SS mit Panzern. Überall wurde die
Erde aufgebuddelt. Alles war dreckig und ungepflegt. Unsere Wohnung und wir
selber auch. Schon lange hingen keine Gardinen mehr an den Fenstern. Abends verhängten
wir sie mit Decken, damit kein Lichtschimmer nach außen drang, sonst wurden wir
schwer als Volksverräter bestraft. Am Anfang besaßen wir gute Rollos – die
waren längst durch die Bombenexplosionen und den dadurch entstandenen Luftdruck
weggefetzt. Unsere Teppiche und Läufer lagen zusammengerollt im Keller und
gammelten vor sich hin. Der Kalkstaub lag auf allem – auf jedem Gegenstand.
Bei jeder Detonation rieselte er aus den Rissen und Ritzen der Wände. Der
herumfliegende Ruß der unaufhörlich brennenden Stadt überzog alles mit
schwarzer Schmiere. Wie lebten mit dem Dreck, denn anders ging es nicht – und
leben wollten wir.
***
Teil
4
Bei den Seelower Höhen gelang es der deutschen Wehrmacht, die Rote Armee, die auf Berlin losmarschieren wollte, fast drei Tage lang in eine gigantische Schlacht schrecklichen Ausmaßes zu verwickeln – aber am Ende siegten die Russen.
Keiner hatte vermutet, dass die Deutschen noch die
Kraft besaßen, so massiven und erbitterten Widerstand zu leisten. Am 18. April
bedeckten tausende Tote beider Seiten das grausige Feld des Kampfes. Noch heute,
nach 60 Jahren, werden immer wieder Skelette, Waffen und Munition ausgegraben,
die das entsetzliche Geschehen auferstehen lassen.
Wir im Osten Berlins hörten das Grummeln und Grollen der großen Schlacht mit angstvollem Herzen. Ab dem 18. April vernahm man endlich den Donner der Geschütze. Nun ging es also los!
Unser Leben wurde fast unerträglich. Berlin
brannte überall und die Menschen wussten vor Angst nicht mehr, was sie tun
sollten. Es fuhr fast keine Bahn mehr. Firmen, Betriebe, Geschäfte und Schulen
schlossen. Viele hatten weder Wasser noch Strom noch Gas in den Häusern. Überall
versprengte umherirrende Soldaten, Ausgebombte und Flüchtlinge. Keiner wusste
mehr, wo er bleiben sollte. Meine Mutter sagte, es wäre, als sei der Irrsinn
ausgebrochen. Ununterbrochen gab es Fliegeralarme, man kam kaum noch raus aus
dem Bunker und aus den Klamotten.
Meine Mutter schürte in der Waschküche im Keller das Feuer unter dem großen Kessel, um alles zu verbrennen, was ihrer Meinung nach die Russen verärgern könnte. Ich jammerte, denn natürlich war ich doch irgendwie ein Kind meiner Zeit. Ich wollte am liebsten alles behalten – aber sie machte Kahla-Rasa unter meinen Sachen. Alle meine Liederbücher und die BDM-Uniform jagte sie durch den Schornstein. Mir fiel das Lied ein »Flamme empor!« Als ich anfing zu summen, hätte mir meine Mutter beinahe eine geklebt. Ihre Nerven lagen blank, fühlte ich. Was Frauen und Mütter in dieser Zeit leisteten, erregt noch heute meine volle Bewunderung. Dass sie nicht zusammenbrachen ist ein Rätsel, aber das Wort Stress hörte ich aus keinem Munde, und ich kann mich an keinen Fall erinnern, in dem eine Frau mal zusammenbrach oder schlapp machte oder durchdrehte. Wir waren ja auch alle darauf getrimmt, durchzuhalten. Durchhalteparolen waren ja unser täglich Brot geworden. Richtiges Brot gab es kaum noch.
Die Sirenen schafften es nicht mehr, die feindlichen Flieger anzukündigen. Heulten sie los – waren die Bomber auch schon da. Nun wurde alles ganz und gar verrückt. Vom 20. April an gab es überhaupt keinen Fliegeralarm mehr. Nun bombardierte man die Stadt pausenlos unangekündigt. Die Hölle brach los. Alles öffentliches Leben, das noch hier und da gezuckt hatte, erstarb. Der Anfang vom Ende kam auf uns zu. Die feindlichen Flugzeuge donnerten dröhnend über uns hinweg und wir befürchteten, jeden Moment würde das Haus über uns zusammenbrechen, uns verschütten oder töten.
Wir konnten das nicht mehr ertragen und
beschlossen, in den Bunker zu ziehen – besser gesagt, zu flüchten und dann
sollte kommen was will. Sich irgendetwas auszudenken, was kommen könnte, gelang
keinem von uns.
Meine beiden Schwestern kamen kaum noch raus aus dem Bunker. Nun
ergriffen also auch meine Mutter und ich unser Notgepäck und so viel
Nahrungsmittel, wie wir für nötig hielten und rannten während einer
Bombenpause schnell über das kleine Stückchen Triftweg entlang und in den
Schutz des Bunkers. Das hört sich so einfach an – aber das war es gar nicht.
Die beiden Flachbunker, die sich gegenüberlagen, waren schon knackevoll. Mehr
als doppelt so viele Menschen als sonst bei Luftangriffen, drängelten sich
hinein. Hauptsächlich Frauen mit Kindern. Männer sah man kaum – vielleicht
mal einen Kranken oder ein ganz alter – auch an die kann ich mich nicht
erinnern. Mein Vater hat nie während eines Fliegeralarms den Bunker aufgesucht.
Er war immer nebenan in der Fleischfabrik. Oft sogar im höchsten Ausblick um,
wenn möglich, auflodernde Brände sofort löschen zu können, was mehr als
einmal gelang. Er war natürlich nicht allein. Immer waren auch noch andere
Arbeiter da und die gefangenen Italiener. Sie alle hüteten die Fabrik wie ihren
Augapfel – als wäre sie ihr Eigentum. Ich glaube, heute gibt es diese
Einstellung zur Arbeitsstelle gar nicht mehr. Dieses Zugehörigkeitsgefühl ist
verloren gegangen.
Weil meine Mutter und ich im großen Schutzraum keinen Platz mehr fanden, drängelten wir uns in den einen der zwei langen Gänge hinein, von dem die kleine Kabine abging, in der meine Schwestern mit den Kindern und noch einer fremden Frau mit ihrem Kind hausten. Normalerweise war es verboten, sich in den Gängen niederzulassen – aber jetzt, in dieser Ausnahmesituation, ließ unser Bunkerwart so viele Frauen und Kinder hinein, wie es nur irgendwie ging. Gegenüber der Kabinentür meiner Schwestern, an der Betonwand des schmalen langen Ganges schlugen meine Mutter und ich unser Lager auf. Die Kabinen selber waren winzig und mit ihren Bettenbewohnern voll besetzt. Sitzhocker gab es nicht- also kampierten wir auf unseren zwei mittelgroßen Koffern und zwei Taschen. Jede von uns beiden legte einen Koffer flach auf die Erde und benutzte die Tasche als Kopfstütze. Mit Geschick konnten sich andere Bunkerinsassen vorbeidrängeln, wenn sie zur Toilette oder in den Waschraum wollten. Das war nervig für uns, aber wir waren gewöhnt, uns in alles klaglos zu fügen. Die beiden langen engen Gänge waren auf einer Seite total von Menschen besetzt, dicht an dicht. Das Gedrängel war groß und immer noch ließ der Bunkerwart Neuankömmlinge hinein. Alles verlief ruhig und diszipliniert.
Aber ich weiß es noch wie heute: Ich konnte nicht mehr. Der ewige Schlafentzug durch die fast ununterbrochenen Fliegeralarme, überwältigte mich nun. Ich krümmte mich auf meinem Koffer zusammen wie ein Embryo und fiel in tiefen Schlaf.
Als ich erwachte, war ein neuer Tag angebrochen.
Wir aßen von den Lebensmitteln, die wir mit hatten, auch meine Schwestern und
die Kinder. Eine Bunkerverpflegung gab es natürlich nicht. Jeder musste für
sich selbst sorgen; aber noch klappte das problemlos und der Tag ließ sich ganz
gut an. Draußen krachte und ballerte es, dass wir es durch die dicken Bunkerwände
deutlich hören konnten; aber wir fühlten uns sicher und behütet vor Bomben
und Granaten. Wenn nur die Angst im Herzen vor dem Kommenden nicht gewesen wäre.
Seltsamerweise verhielten sich die unsagbar vielen Kinder im Bunker bewundernswert artig. Sie blieben ruhig wie kleine Tiere, die eine unbestimmte Gefahr wittern. Ich glaube, es war ein Ur-Instinkt, der sie so leise machte.
Ich hielt es nicht mehr aus. Ich wollte raus – und ich machte mir Sorgen um mein Hündchen. Mein Vater hatte mir zwar versprochen, sich um alles zu kümmern, aber der Kleine kam vor Angst bestimmt fast um. Und ich hatte ein Verlangen nach warmem Essen. Wir alle hatten tagelang nichts Gekochtes mehr gegessen. Ich wusste, daß in der Wohnung noch rohe Kartoffeln waren. Also bettelte ich meine Mutter so lange an, bis sie mir erlaubte, den Bunker zu verlassen, in unsere Wohnung zu flitzen – und wenn es noch wirklich Gas geben sollte, die Kartoffeln zu kochen und in den Bunker zu bringen. Wir wollten sie dann gemeinsam mit Salz und dem Rest Butter, den wir noch hatten, aufessen.
Das meine Mutter mir das wirklich erlaubte, ist mir aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbar – aber damals war die Lage wirklich anders. Wir waren so an große Gefahren gewöhnt, dass man sich leichter hinein begab.
Der Bunkerwart fragte mich: »Willst du wirklich raus?«, als er die Tür öffnete. Ja, ich wollte- und schlüpfte hinaus. Es waren ja nur wenige Schritte zu unserer Wohnung – was sollte da schon passieren?
Es herrschte wunderschönes Frühlingswetter, aber
alles sah so verändert aus. Es war nicht mehr die Welt, in der ich groß
geworden war und ich wusste noch nicht, daß sie niemals mehr so aussehen würde
wie einst. Sie war versunken wie Atlantis. Deutsche Soldaten liefen oder
lungerten herum. Alles Heldenhafte schien von ihnen abgefallen zu sein. Sie
wirkten nur noch erschöpft und ungewaschen. Volkssturmmänner und Fremdarbeiter
gruben Panzersperren. Vor der Brücke, die über die Treskowallee führte, stand
eine ausgebrannte Straßenbahn. Später schob man sie unter die Brücke, um die
Straße zu sperren. Was natürlich reinster Blödsinn war. Auch im Triftweg
zwischen Bunker und dem alten kleinen roten Wasserwerk, in dem heute Lidl
residiert, sollte so eine dämliche Panzersperre den Vormarsch der Roten Armee
aufhalten. Man grub Ein- Mann-Löcher und Gräben. Es gab neue Bombentrichter
und kleinere Granateinschläge, denn die Gegend lag unter Artilleriebeschuss.
Viele SS-Männer wuselten umher. Das Durcheinander konnte kaum noch überboten
werden. Mich ängstigte das eigentlich nicht. Ich, als ein Kind des Krieges, war
so langsam aber unaufhaltsam in das große Chaos hineingewachsen, dass ich es
gar nicht mehr registrierte. Es war eben so, wie es war!
Ich freute mich sogar darüber, dem sicheren Bunker entronnen zu sein und fast vergnügt trabte ich unserer nahen Wohnung zu. Da auf einmal, ein ohrenbetäubendes Jaulen in der Luft!. Das Motorengetöse eines feindlichen Flugzeugs, dass so niedrig über das Pflaster des Triftweges flog, als wollte es jeden Moment landen und mich platt walzen. Dazu noch das Tackern der Bordkanone und das etwas leisere Klatschen der Einschüsse.
Jetzt glaubte ich doch, dass es mich nun erwischen würde. Ich schmiss mich in die Sträucher, die vor der Fabrik standen und lauerte darauf, dass mich ein Schuss treffen würde. Aber es traf mich keiner. Der Tiefflieger war weitergerast. Wenn der Bordschütze gewollt hätte, hätte er mich mit Leichtigkeit ins Jenseits pusten können, aber mit Sicherheit hatte er sich mehr auf die große Flakstellung konzentriert, die hinter dem roten Wasserwerk lag. Darüber hatte er mich übersehen, denn ansonsten schossen die Brüder auf alles, was sich bewegte. Noch lebte die Flakstellung. Die schweren 8,8 cm Geschütze hatte man zwar hinter die Pionierkaserne für den Bodenkampf verlegt, aber dafür RAD Flak 10,5 stationiert und kleine 2 cm Zwillingsflak-45. Das erzählte mir alles Wölfchen, der kannte sich genau aus.
Die Sträucher, zwischen die ich mich geschmissen hatte, waren für mich als Schutz auch denkbar ungeeignet gewesen, der Frühling war ja noch viel zu jung. Es gab zwar schon kleine Knospen, aber noch lange keine Blätter. Es muss ein reiner Reflex gewesen sein, dass ich mich da rein schmiss. Ich rappelte mich ziemlich verschreckt auf und rannte in unsere Wohnung. Wir wohnten gleich im ersten Aufgang der Kriegerheimsiedlung. Damals Triftweg 67, heute Ontarioseestraße Nr. 14, Hochparterre rechts. Es schien weiter keiner im Haus zu sein. Ich fühlte richtige Glücksgefühle in mir aufsteigen, als ich dann inmitten von Scherben und Zementdreck in unserer Küche auf der Erde kauerte und mein zitterndes Hündchen in die Arme nahm und zärtlich beschmuste. Der kleine Kerl war so verschüchtert, dass er mich nicht einmal begrüßt hatte. Vorwurfsvoll traf mich sein ratloser und beleidigter Blick. Er kam nicht von alleine aus seiner Kiste heraus, nur sein buschiges Schwänzchen klopfte leicht auf sein Kissen, als er sah, daß ich es war. Ich tröstete und streichelte ihn. Er musste alleine bleiben, denn mitnehmen konnte ich ihn nicht. Tiere durften nicht in den Bunker.
Zum Glück gab es Wasser und Gas. Ich setzte die
Kartoffeln auf. Da plötzlich, ein explosionsartiger Knall in unmittelbarer Nähe.
Später entdeckte ich im Nebenhaus in der oberen Wohnung ein großes Loch in der
Außenwand von einem Artilleriegeschoss. Ich muss gestehen, dass sich meine Glückgefühle
nun doch schnell verflüchtigten und ich, als die Kartoffeln gar waren, auf dem
schnellsten Weg in den rettenden Bunker zurück rannte.
Ich kann nun nicht mehr ganz genau die Ereignisse reihenmäßig den
folgenden Tagen zuordnen, weil es nur noch eine einzige große Katastrophe war,
in der wir uns befanden und nur noch eine einzige große Angst vor den Russen.
Wir wussten auch nicht mehr, ob es Tag oder Nacht war, aber mein Vater sagte es
uns immer – er kam jeden Tag einmal zu uns, um uns etwas zu essen zu bringen
und einen Lagebericht abzugeben. Alles spitzte sich zu. Von einer Wenck-Armee,
die uns retten sollte, hörte man weit und breit nichts. Die Russen würden
kommen wie das Amen in der Kirche.
Die Angst verschloss unsere Münder. Ich kann mich an kein Gespräch
erinnern, dass ich mit einer Freundin oder sonst jemanden aus unserer Clique geführt
habe. Die, die zusammengehörten, huckten beieinander und warteten schweigend.
Jede Familie bildete eine Insel für sich.
Dann auf einmal, gab es kein Wasser mehr und dadurch auch keine
Toilettenspülung. Im Nu verstopften alle Klos. Das erwies sich als eine
Katastrophe in der Katastrophe. Wir waren hunderte Menschen – davon fast die Hälfte
Kinder. Darunter viele kleine Hosenscheißerchen und Säuglinge, die in die
Windeln machten. Und die Erwachsenen mussten ja auch mehrmals am Tag das stille
Örtchen aufsuchen. Nun wurde es schlimm. Die Mütter konnten keine Windeln mehr
ausspülen, man konnte nicht mehr aufs Klo – und Trinkwasser gab es auch keins
mehr. Es dauerte nur kurze Zeit und bestialischer Gestank erfüllte die Luft im
Bunker. Man roch es nur in den ersten Stunden – dann nicht mehr. Jetzt brach
die große Zeit unserer Pimpfe und Hitlerjungen an. Es erfolgte eine Durchsage,
dass man Freiwillige suche, die Wasser holten. Na, das war doch eine Ehrensache,
dass sich die, die da waren, auch meldeten. Die wenigen Jungen und Männer
standen meistens an den beiden Eingängen in der so genannten Schleuse. Wenn es
die Situation erlaubte, beobachteten sie das Geschehen draußen etwas durch die
nicht ganz geschlossene äußere eiserne Bunkertür.
Es ist vollkommen klar, dass sich die Wasserträger in Lebensgefahr
begaben. Jeder bekam zwei Eimer und wanderte los. Ihr Ziel war das Laubengelände,
das gleich hinter unserer Siedlung begann, und sich bis hoch nach Rummelsburg
erstreckte. Schon gleich in den ersten Gärten gab es Pumpen, die Wasser aus der
Erde pumpten. Keinem der Wasserträger passierte etwas. Alle kamen immer zurück
und brachten das kostbare Nass. Als der Endkampf begann, ließ der Bunkerwart
sie selbstverständlich nicht mehr hinaus.
Auch Gerhard Sack, der zwölfjährige Bruder meiner Freundin Margot, die in Dahme in der Mark ihr Pflichtjahr absolvierte, war bei den Wasserholern. Unterwegs fing ihn Herr Radelhof, der in der Wohnung über Sacks mit seiner Familie wohnte, ab und teilte ihm mit, dass gerade sein Vater erschossen worden war und Gerhard möchte doch mit nach Hause kommen. Herr Sack, ein beinamputierter Invalide aus dem I. Weltkrieg, hatte es immer für unter seiner Würde betrachtet, Schutz im Bunker zu suchen. Das war nur was für Frauen und Kinder. Aber an diesem Tag hatte er hingewollt, um seiner Frau, dem Gerhard und dem 2½ jährigen Werner etwas zu essen zu bringen. Weil es ihm zu gefährlich erschien, das ganze Stück auf dem Triftweg entlang zu laufen, beschloss er, durch den Kellerausgang das Haus zu verlassen und durch die Gärten an unserem Häuserblock geschützter voranzukommen. Ein Stück Triftweg blieb ihm immer noch.
Aber schon in den Gärten an den Balkons traf ihn eine Kugel tödlich. Man schleppte ihn in sein Haus zurück und legte ihn in der kühlen Waschküche im Keller auf ein Sofa.
Die Russen, von Karlshorst kommend, lagen also schon hinter dem Bahndamm, der unsere kleinen Gärten begrenzte. Von dort aus hatte ihn die tödliche Kugel getroffen. Es war nur ein einzelner Schuss – wahrscheinlich von einem Scharfschützen.
Auf dem später ausgestellten Totenschein steht das Datum vom 23.April 1945.
Dann der nächste Schlag für uns Bunkerinsassen: Der Strom fiel aus! Nun hatten wir kein Licht mehr und keine Entlüftung. In der ersten Zeit nach dem Ausfall funktionierte noch das Notaggregat, dann, nach einiger Zeit, versagte das auch.
Erschwerend kam hinzu, dass nun draußen die Hölle los war. Der Lärm wurde unbeschreiblich. Alle Teufel schienen los zu sein und es stank durch die kleine Luke, die eine winzige Frischluftzufuhr für die Kabine war, fürchterlich zu uns herein. Wir wussten jetzt, ohne daß es uns jemand sagte, daß draußen der Endkampf tobte. Keiner im Bunker jammerte oder gebärdete sich hysterisch. Alle blieben sehr gefasst. Meine Mutter und ich waren in die Kabine zu Gisela und Evchen und zu den Kindern gegangen und wir setzten uns mit dem Gepäck an ein Stückchen freie Wand. Die Angst ließ uns noch mehr zusammenrücken. Von Mund zu Mund gab man den Befehl weiter, dass die Luken in den Kabinen mit der Klappe zu verschließen sind. Das machten wir mit der Blechklappe, die dafür vorgesehen war. So saßen wir nun, auf das Ende wartend in der finsteren Kabine, fast ohne Sauerstoff. Wir zündeten eine Kerze an, aber die wollte und wollte kein Licht geben; aber ihr winziges zuckendes kleines Flämmlein beruhigte uns etwas, denn wir kamen uns vor, so ohne Wasser, ohne Licht und ohne Sauerstoff zwischen den Hunderten von Menschen wie lebendig Begrabene. Alle Bunkertüren waren fest verschlossen und verriegelt. Draußen wütete die Schlacht. Es ging rund. Von Mund zu Mund pflanzte es sich fort: Die Russen sind da!
Auf dem Kalender stand: 24.April 1945.
Nun war es also soweit: Alle wirkten sehr gefasst
– sehr still. In der Schleusenkammer schufteten die wenigen Männer mit den größeren
Jungen wie die Schwerarbeiter an dem Rad der Luftzufuhr, dass man in der Not
selber drehen konnte. Ich glaube, sie bewahrten uns vor dem Erstickungstod.
Dann kamen ein paar fanatische halbstarke
Hitlerjungen auf die ruhmreiche Idee, unseren Bunker zu verteidigen. Aber zum Glück
gab es ein paar mutige Männer und etliche couragierte Mütter in der Nähe, die
diesen Idioten sofort den Marsch bliesen. Nun waren wir schon so weit – nun
wollten wir auch überleben.
Als sich draußen der Krach und das Getöse etwas beruhigten, öffnete
der Bunkerwart ganz, ganz vorsichtig die eine Eisentür zur Außenwelt und
schwenkte ein weißes Bettlaken, dass an einen Besenstiel gebunden war – zum
Zeichen, daß sich die Menschen im Bunker dem Feind ohne Widerstand ergeben.
Für uns in der Kabine stand die Welt und das ganze
Leben still. Würde man uns nun alle abmurksen? Also ehrlich – irgendwie
glaubte ich das nicht mehr- aber genau konnte man es nicht wissen. Wir saßen
lange stumm und abwartend einfach nur so da und warteten auf irgendetwas. Ganz
plötzlich stand ein junger Russe vor unserer Kabinentür. Wir konnten ihn ganz
genau sehen, denn seit beide Türen des Bunkers offen standen, gab es etwas wie
leichten Durchzug und unser Flämmchen hatte sich erholt. Wir hatten auch die
Luftluke wieder öffnen dürfen. Es war ein ganz junger Mensch, der da vor uns
stand. Er schien zu den unteren Dienstgraden zu gehören. Sein Gesicht war das
eines pfiffigen Bauernburschen, voller Blatternarben und durch die
Kampfhandlungen verdreckt – genau wie seine Uniform. Er grinste und sagte »Gitler
kaput, Uri, Uri!« und mit der Hand machte er eine nicht miss zu verstehende
Geste, die wir sofort verstanden. Er zeigte auf einen Korb, der ihm am anderen
Arm hing. In dem lagen schon ungefähr 100 Armbanduhren – und wir sollten
unsere dazulegen. Was blieb uns anderes übrig? Jede nahm artig ihre Uhr vom
Handgelenk und legte sie in den Korb des ersten Siegers, der uns begegnete. Auch
meine hübsche Konfirmationsuhr landete bei der Roten Armee. Aber komisch! Ich
wusste plötzlich, dass Russen Menschen waren. In mir keimte die Hoffnung, dass
es mit der Leberei weitergehen würde.
Nach einiger Zeit, die uns unendlich lange vorkam, hieß es plötzlich: »Wir sollen raus aus dem Bunker und nach Hause gehen«. Wie im Traum nahmen wir unser Gepäck und die beiden Kinder und schoben uns in der Schlange vorwärts zum Ausgang. Dann sahen wir den Schein von Sonnenlicht. Es war also Tag! Ein wundervoller Frühlingstag!
Die Schlange der Frauen und Kinder schob sich nur ganz langsam voran. Alle zögerten, den beschützenden Bunker zu verlassen. Niemand wusste, was ihn draußen erwartete. Es blieb uns aber nichts anderes übrig. Wir mussten hinaus.
Und dann sah ich es – mein neues Leben – das
nun doch weiterging – nur anders.
Es bot sich mir ein Bild wie auf einer Operettenbühne! Ich hatte ja noch nie eine siegreiche kämpfende Truppe gesehen. Dazu noch eine russische. Hunderte von Soldaten wuselten herum. Die meisten schienen ein Ziel zu haben: Vorwärts! So viele fremdländische Gesichter über verdreckten braunen Uniformen, die so anders aussahen als die feldgrauen der deutschen Soldaten, irritierten mich. Viele wirkten um die Füße herum direkt etwas lumpig. Aber dann waren da wieder elegante Offiziere – nobel wie Aristokraten. Deren Stiefel sah man an, dass sie viel Geld gekostet hatten. Weich und glänzend blinkte das Leder im Licht. Der Erfolg über den Sieg in Karlshorst schien alle befriedigt zu haben. Man sah viele lachende Gesichter. Alle Volksstämme Asiens bis hoch zum Eismeer schienen am Kampf um uns teilgenommen zu haben. Der Sieg schien sie im Moment friedlich zu stimmen, was wir mit einer Riesenerleichterung registrierten. Über das Pflaster des Triftwegs zog ein unaufhörlicher Strom von Rotarmisten mit Kriegsgerät. Panzern und Kanonen, Wagen mit Munition und Verpflegung. Panjewagen auf Panjewagen, gezogen von kleinen, zottigen Pferdchen. Sogar Kamele zogen hoch nach Rummelsburg. Auf einem Panzer, außen neben dem Turm, saß eine Russin in Uniform und warf aus einer Kiste dicke Stücken Brot unter die Bevölkerung. Kinder liefen nebenher und fingen die Stücke auf. Zwischen dem Fahrdamm und den Bunkern befand sich ein mehrere Meter breiter Sand- und Grasstreifen.
Auf diesem
Streifen vor dem Bunker stand ein ausgebrannter deutscher Panzer. Man erzählte
mir später, während des Ausbrennens habe es ein entsetzliches Todesschreien
gegeben. Ein Soldat war eingeklemmt und konnte sich nicht retten. Als brennende
schreiende Fackel brannte er, bis er kohlrabenschwarz war. Ein kleines Stückchen
weiter standen wieder zwei ausgebrannte Panzer und ein vierter drüben auf der
anderen Seite der Treskowallee, wo sich der Weg zum Arbeitserziehungslager
Wuhlheide befand. Die verbrannten schwarzen Menschenkörper, die herumlagen,
kamen mir vor, als wären sie nur noch halb so groß. Überall lag Schutt,
kaputtes Kriegsgerät und das Erdreich war durch die Panzer aufgewühlt wie ein
Acker.
Die ganze Gegend war wie durchgepflügt und mit Bomben- und
Granattrichtern gespickt. Vor dem nun zerlumpten, zerfetzten Akazienwäldchen saßen
kleine Gruppen von ausgemergelten elenden Männern. Es waren die endlich
befreiten Häftlinge aus dem Arbeitserziehungslager Wuhlheide auf der anderen
Seite des Triftweges. Ganz ruhig und staunend huckten sie da auf der Erde und
besahen sich das Schauspiel. Vielleicht waren sie endlich mal satt –
vielleicht glaubten sie zu träumen – aber was das Bild, das sich mir bot, so
operettenhaft machte, war ein Trupp Kosaken auf prächtigen Pferden, die unruhig
hin und her trabten. Ich hatte noch nie Kosaken in Natura gesehen. Prächtig
sahen sie mit ihren Umhängen und den ihnen typischen Mützen aus. Immer wenn
ich an ihr Aussehen denke, fällt mir die Farbe Rot ein. Ich habe nie wieder
Kosaken gesehen. Ob das Rot von ihren Mützen kam oder ob der Umhang rot gefüttert
war. Man glaubt mir nie, wenn ich von den Kosaken erzähle – aber ich kann es
beschwören: Am 24.April 1945 tänzelten ihre Pferde um unseren Bunker. Zwischen
all dem Gewusel auch schon wieder Flüchtlinge mit Hand- und Kinderwagen
hoch bepackt weiterziehend.
Das blaue Tor der Fleischfabrik (die 1996 abgerissen wurde) stand weit offen. Natürlich war die Fabrik von russischen Soldaten besetzt. Gerade als wir vorbeiliefen, kamen zwei Russen in ihrer blusenartigen Uniform vergnügt herausspaziert. Einer ging vorne, der andere ein Stück hinter ihm. Jeder hatte das Ende eines langen Metallspießes auf einer Schulter. An dem Spieß hingen viele, viele geräucherte Würste, die sie an die Frauen und Kinder verteilten. Dieser Anblick erinnerte mich sofort an alte Bauernbilder aus dem Mittelalter, auf denen ländliche Szenen dargestellt wurden.
Durch dieses Durcheinander zogen aus beiden Bunkern
die Hunderte von Frauen mit ihren Kindern wie Ameisenzüge. Die meisten an
unserer Siedlung vorbei auf das Laubengelände. Es gab keinen Jubel, eher eine
erstaunte Erleichterung. Noch gab es keine Belästigungen. In unserer Gegend
benahm sich die kämpfende Truppe anständig. Sie war müde und erschöpft und
erst einmal durch den Etappensieg befriedigt und erleichtert. Sie ließ uns in
Ruhe.
Meinen Vater hatten wir nicht entdecken können. Nach Hause hatten wir es nicht weit. Irgendwie schienen wir wie in Trance zu sein. In die Wohnung wollten wir nicht, weil es uns dort noch zu gefährlich erschien. Russische Flugzeuge dröhnten im Tiefflug über uns hinweg zu noch nicht eroberten Stadtteilen Berlins. Russische Artillerie beschoss ihre neuen Ziele. Nicht weit von uns, in einem kleinen winzigen Wäldchen hinter dem Bahndamm, hatte man eine Stalinorgel aufgebaut. Ich glaube, die Russen nannten sie Katjuscha. Die orgelte und jaulte Stunde um Stunde über uns hinweg. Die vielen Panzer, die Richtung Innenstadt ratterten, ließen unsere Häuser erzittern. Der Krach war auf die Dauer kaum auszuhalten.
Meine Mutter zog mit uns in den Luftschutzkeller.
Was wir an Betten brauchten, holten wir uns aus der Wohnung. Bettgestelle
standen sowieso im Keller. Vorsorglich hatte mein Vater einen kleinen eisernen
Ofen installiert, auf dem meine Mutter Eintopf kochen konnte. Kohlen hatten wir
genug in unserem Keller nebenan.
Wir empfanden keine Freude, keine Erleichterung, über die, wie man später sagte, Befreiung. Eigentlich empfanden wir nichts. Wir waren mit Überleben beschäftigt. Zuerst stillten wir unseren Durst. In einem Rinnsal kam aus unserer Leitung im Keller sogar Wasser, was eine große Erleichterung darstellte. Wir hatten im Keller einen kleinen Toilettenraum mit Waschbecken neben der Waschküche. Was für ein Luxus plötzlich! Alle 6 Mieterparteien aus unserem Haus waren nicht anwesend. Die, die da waren, lebten in ihren eigenen Kellern, die sie für den Notfall vorbereitet hatten. Gleich neben unserem Luftschutzkeller hausten nun Walters.
Frau Walter, schon etwas älter, sehr nett, war in der Fleischfabrik Bürovorsteherin.
Irgendwann betrachtete ich staunend und schmunzelnd ihren Hinterkopf. Sie hatte schönes, rötlich braunlockiges langes Haar, das sie immer zu einem losen Dutt aufsteckte. Neuerdings waren ihr wohl die Haarnadeln ausgegangen. Statt ihrer bändigte sie ihre Lockenpracht mit langen Eisennägeln. Sie hatte sich auf jeden Fall zu helfen gewusst.
Dann Inge Walter, die Tochter im Alter meiner Schwestern und Herr Walter. Herr Walter, auch sehr nett (Beruf unbekannt), trug einen mittellangen Bart und wurde, heimlich nur, der Spitzbart genannt. Er übernahm für unsere Gemeinschaft den wichtigsten Posten. Er wurde unser Haustürwart. Zuerst verstärkte er sie von innen mit Brettern, damit man sie nicht so leicht eintrampeln konnte und setzte sich Tag und Nacht auf einen Lehnstuhl dahinter. Wir beobachteten das etwa ratlos, aber er behauptete steif und fest: »Kinder täuscht euch nicht – das ist doch nur der Anfang – das dicke Ende kommt noch!«
Ich dachte insgeheim: »Was soll schon noch kommen – sie sind doch schon da!« Herr Walter erzählte von einem Ilja Ehrenburg, der die russischen Soldaten aufgerufen haben sollte, alle Deutschen zu töten und alle Frauen zu vergewaltigen.
Das trug ja nun auch nicht gerade dazu bei, uns zu beruhigen. Ich gruselte mich schrecklich – aber mich würde das vielleicht nicht betreffen – ich war ja erst fünfzehn.
Während das eiserne Öfchen bullerte und
versuchte, die Kälte im Luftschutzkeller zu vertreiben, stand ich mit meiner
Mutter im Kellergang. Ich stierte auf die kleine Scheibe Fensterglas, die im
oberen Teil der Tür eingebaut war, die nach hinten in die Gärten führte. Nun
hatten sich die Russen mit ihren Pferden dort niedergelassen und ließen sie
grasen und alles niedertrampeln. Mich zog die Glasscheibe, die ein Stück blauen
Himmel zeigte, magisch an. Ich war wie süchtig nach Tageslicht – nach Sonne.
Draußen herrschte herrlichster Frühling.
Nur für unsere beiden kleinen Jungen Peter und Hans-Jürgen war die
Finsternis, zu der wir verdammt waren, gut, denn beide hatten eine Krankheit
erwischt. Sie lagen flach mit Masern oder Windpocken. Was es genau war, wussten
wir nicht, denn einen Arzt gab es nicht.
Unseren Durst hatten wir gestillt – nun quälten
uns verstärkt Angst und Hunger. Brot gab es schon lange nicht mehr. Uns erfüllte
die größte Sorge um meinen Vater. Teilte er etwa das Schicksal von Margots
Vater? An den Verwüstungen im Triftweg um den Bunker herum, hatte man erkennen
können, dass es heftige Kämpfe gegeben hatte. Wir hatten noch nichts gehört
oder gesehen von meinem Vater. Das war eigentlich nicht seine Art. Er spielte in
meinem Leben die absolute Hauptrolle. Er war mein großer Zampano. Ich war die
klassische Vatertochter.
Plötzlich Gebummere an der verbarrikadierten Haustür. Ausländisches
Palaver in gebrochenem Deutsch – aber kein Russisch. Herr Walter öffnete –
und dann kam Palo vergnügt die Kellertreppe runter. Er hielt uns einen großen
Henkeltopf hin und sagte: »Ich weiß – der Hunger – ich bringe Essen –
meine Kameraden gekocht« Wir konnten vor Überraschung erst mal keinen Ton
raus bringen. Er übergab meiner Mutter den großen Topf. Er legte eine seiner Hände
auf seine Brust und stieß erregt hervor: »Mutti! Ich glücklich – ich frei!«
»Ja«, sagte meine Mutter freundlich: »Herzlichen Glückwunsch! Du jetzt frei
– dafür wir alle Gefangene!« Palo lachte, umarmte meine Mutter samt
Suppentopf und beruhigte sie »nein, nein«. Mich fragte er: »Du gutt?« Ich
nickte nur. Dann bestellte er in seinem komischen Deutsch viele Grüße von
unserem Vater. Es ging ihm gut, er hatte keine Verletzung – aber er musste in
der Fabrik bleiben. Die Fabrik war voll Fleisch und mein Vater kannte sich als
einziger mit der Kühlung aus. Er war ja kein Fleischer, sondern
Maschinenmeister. Ein russischer Kapitän verwaltete nun alles und verlangte,
dass mein Vater vorwiegend anwesend war. Er wurde auch von ihnen verpflegt.
Hauptsächlich mit Speck, Brot und Wodka. Es sei ein Dolmetscher da und alles
klappte ohne Schwierigkeiten. Palo arbeitete wie schon lange als Gehilfe unseres
Vaters.
So weit – so gut! Wir fühlten uns etwas beruhigt. Mein Vater kam öfters
kurz zu uns, um zu sehen, wie es uns ging und wie wir zurechtkamen. Zwischendurch
erschien auch immer wieder Palo, um uns Essen zu bringen, scherzte mit meinen
Schwestern, sah nach den kleinen Jungen und streichelte sie. Mich lächelte er
immer nur an.
Allmählich wurde unsere Lage bedrohlicher. Unentwegt polterten nun russische Soldatentrupps an unsere Haustür. Mit Fäusten, Stiefeln und Gewehrkolben donnerten sie dagegen, dass sie fast zersplitterte. Natürlich blieb Herrn Walter nichts anderes übrig, als aufzumachen. Sie suchten das ganze Haus von oben bis unten nach versteckten deutschen Soldaten ab. Auch unsere Keller verschonten sie nicht.
Wir saßen dann immer ganz still und verschüchtert auf unseren Plätzen und ließen es über uns ergehen.
Der erste Trupp, der kam, nahm meiner Mutter ihre große schwere Lederhandtasche weg, die sie krampfhaft auf ihrem Schoß festhielt. Weg war sie – auf Nimmerwiedersehen! Es war ja auch der größte Blödsinn gewesen, sie so sichtbar an sich zu drücken, dass jeder ahnen konnte, es müsse etwas Gutes drin stecken. Und so kam es ja auch. Auf einen Schlag hatten wir keine Papiere mehr, keine Lieblingsfotos und Mutti keinen Schmuck mehr. Und so bürgerte es sich ein: Was den Russen gefiel, nahmen sie mit.
Sie waren dann so schlau, dass sie gleich, nachdem
sie zu uns in den Keller kamen, erst einmal die Petroleumlampe höher
schraubten. Elektrisches Licht gab es noch nicht.
Manchmal, aber sehr selten, schlich sich eine Nachbarin oder ein Nachbar heimlich von Haus zu Haus, um Nachrichten auszutauschen. Jeder kannte in der Kriegerheimsiedlung jeden und alle verstanden sich. So kam Frau Radelhof, um zu erzählen, dass neben Thiemanns Ladenbude etliche Tote eingebuddelt werden. Darunter Herr Sack, ein Ehepaar aus dem Nebenhaus, das sich das Leben genommen hatte und ein ganz junger Soldat, der in dem Einmann-Loch gehuckt hatte, in dem die Jungens später die alten abgelatschten Filzstiefel eines russischen Soldaten versenkten, nach dem man dem Günter seine geklaut hatte. Überall legte man kleine Soldatenfriedhöfe an. Deutsche und Russen lagen oft friedlich nebeneinander, aber gut gekennzeichnet.
Dann erzählte Frau Radelhof noch, Frau Sack sei
auf eine wunderliche abenteuerliche Reise gegangen. Sie habe ihr letztes Essen
eingepackt, den 2-jährigen Werner in den Sportkinderwagen gesetzt und sei mit
dem 12-jährigen Gerhard losmarschiert, um Margot aus Dahme nach Hause zu holen.
Alle hatten ihr abgeraten, weil es jedem viel zu gefährlich erschien, aber Frau
Sack erwies sich als echte Mutter Courage und ließ sich von ihrem Vorhaben
nicht abbringen. Sie marschierte einfach los mit ihren zwei Kindern, um ihr
drittes heimzuholen.
Mein kleiner Hund Peggy lebte jetzt mit uns im Keller und schlabberte wie wir die Mehlsuppe, die meine Mutter auf dem Kanonenofen kochte und mit Süßstoff abschmeckte. Wir liebten diese Suppe besonders, wenn viele Klümpchen in ihr schwammen, dann machte sie satter.
Normalerweise war der kleine Köter ein Giftzwerg
und stand in dem Ruf, ein falsches Luder zu sein. Jetzt im Keller zeigte er ein
total verändertes Wesen. Er muss unsere Furcht gespürt haben – und die
machte ihm Angst. Wenn Russen in unseren Keller kamen, verkroch er sich sofort
stillschweigend unter das Bettgestell und gab keinen Mucks mehr von sich. Er fühlte
die gefährliche Situation, die in der Luft lag, ganz genau.
Vor Bomben brauchten wir nun keine Angst mehr zu haben – wir lagen ja nun hinter der Front – hinter der kämpfenden russischen Armee, die mit der Eroberung der Innenstadt beschäftigt war und sicher nicht die eigene Truppe bombardierte. Die kämpfende Truppe hatte uns weitgehend geschont, aber die nachfolgenden Russen schienen es anders zu halten: Wir hörten immer öfter von schlimmen Ausschreitungen, grundlosen Erschießungen, Plünderungen und Vergewaltigungen.
Noch war keinem von uns etwas Ernsthaftes passiert.
Der Kapitän in der Fabrik sagte zu meinem Vater, wenn bei uns im Haus etwas Böses
geschehen sollte, oder sich auch nur ankündigte, solle sofort jemand zu ihm
gerannt kommen. Er schickt dann Soldaten, die uns helfen. Das beruhigte uns
irgendwie.
***
Teil
5
26.April
Ob es Tag oder Nacht war, weiß ich nicht mehr, denn jedes Zeitgefühl hatte mich verlassen. Aber ich kann mich erinnern, dass wir aufrecht saßen, als wieder eine neue Horde Russen an unsere Haustür donnerte. Sie traten mit ihren Stiefeln dagegen und schlugen die Gewehrkolben dröhnend gegen das Holz, als wollten sie es einschlagen. Sie schrieen für uns unverständliche russische Worte, von denen wir nur dawai dawai erkannten, weil wir das in den letzten Tagen schon oft gehört hatten. Herr Walter versuchte wie immer, sie mit beruhigenden Worten etwas hinzuhalten – das Öffnen der Tür etwas hinauszuziehen – bis ihm letztendlich nichts anderes übrig blieb, als aufzumachen, denn sonst hätten sie sie wirklich eingeschlagen oder mit einer Garbe aus ihren Maschinengewehren zerfetzt.
Meine Mutter drehte den Schein der Petroleumlampe herunter, so dass wir Frauen und Kinder noch mehr Gespenstern glichen. Ich weiß noch, dass sie »O Gott« flüsterte. Weiter fiel kein Wort, die Angst verschloss uns die Kehle. Sogar Peggy, mein angriffslustiger kleiner Hund verkroch sich wieder unter einem Bettgestell. Die Kinder gaben keinen Mucks von sich. Wie kleine Tiere witterten auch sie die Gefahr und verhielten sich mucksmäuschenstill. Ich verkroch mich tiefer in meine dunkle Ecke.
Ich hörte, wie Herr Walter laut und besänftigend immer ja ja rief und umständlich mit den Schlüsseln hantierte und aufschloss. Die gebieterischen Befehle der Russen wurden immer lauter. Stiefel polterten die Kellertreppe zu uns herunter. Viele Stiefel – es wurde geschrieen und gebrüllt. Wir verstanden nichts. Etliche Russen kamen zu uns herein. Wie üblich schraubten sie als erstes die Petroleumlampe wieder hoch. Hastig und aufgeregt, die Gewehre im Anschlag, sahen sie sich um. Andere Russen verteilten sich in den übrigen Kellerräumen. Zuerst glaubte ich, sie suchen deutsche Männer – deutsche Soldaten. Ich war beruhigt, denn die würden sie bei uns nicht finden. Wir hatten niemanden versteckt. Aber dann fand einer mich.
Ein Aufleuchten ging über sein Gesicht. Mit einer Hand winkte er mich zu sich, mit der anderen schwenkte er den Lauf seiner Maschinenpistole drohend durch unseren Keller und über meine Familie. Fordernd und barsch rief er mir in gebrochenem Deutsch zu: »Du Frau komm!« Ich stand auf und ging. Es stand total außer Frage, dass ich meine Mutter, meine Schwestern und die Kinder nicht gefährden durfte – also stand ich wortlos auf und ging. Es hielt mich auch keiner zurück und keiner schrie auf.
Der Russe führte mich in den Kellergang. Seine Kameraden bildeten ein Spalier, durch das ich hindurch musste. Es wurde still. Einer nahm mir das Kopftuch ab. Sie grinsten zufrieden über ihre viel versprechende Beute. Es war eine wilde Horde, die mich umstand: Dreckige Uniformen, bis an die Zähne bewaffnet, wahrscheinlich kampfbereit, aufgeregt, scheinbar aus allen Steppen der Weite Russlands zusammengewürfelt. Total fremdländisch aussehend. Ich roch ihren Schweiß und den Geruch von Pferden. Schwarze Augen blickten mich gierig an. Ich war eingekreist. Das Wild war gestellt!
Da passierte mit mir etwas Seltsames. Ich verließ mich. Ich fiel in eine geistige Teilnahmslosigkeit. Nichts berührte mich mehr – nichts ängstigte mich mehr. Alles passierte einer anderen. Ja – ich fühlte, ich sah, ich hörte, aber es interessierte mich nicht mehr. Es ging mich persönlich gar nichts mehr an.
Ich konnte auch laufen – denn man führte mich in einen Kellerraum, der leer stand. Als ich ihn betreten hatte, schloss man hinter mir die Tür. Es war dunkel, aber es leuchtete irgendwo ein Licht auf der Erde. Erst glaubte ich, ich sei allein, aber dann sah ich einen einzelnen Russen – einen Mongolen – einen Tartaren – ich weiß nicht, aus welcher Steppe er kam. Die Tür ging wieder auf und ein junger Russe wollte ein zweites Licht bringen, aber das schien dem Mongolen nicht zu passen. Scharf zischte er ein einziges Wort und machte mit einer Hand eine herrische Bewegung, die so viel bedeutete wie, der Bursche möge sich auf der Stelle aus dem Staub machen, was der auch erschrocken tat und die Tür wieder hinter sich zumachte.
Ich stand dem Mongolen nun gegenüber, still und stumm. Er betrachtete mich auch, ohne ein Wort zu sagen. Er war vollkommen unbewaffnet und wirkte nicht bösartig.
Er gab mir zu verstehen, ich solle mich hinlegen. Ich sah im Kerzenschein, dass da, wo ich mich hinlegen sollte, eine Zeltplane ausgebreitet lag. Mir war alles egal – ich ging hin und legte mich. Einmal setzte ich mich noch auf, um meinen Rock herunterzuziehen und glatt zu streichen, denn auf alle Fälle wollte ich einen ordentlichen Eindruck machen.
Er schien irritiert zu sein. Nachdenklich sah er von oben mit seinen schwarzen Schlitzaugen auf mich herab. Dann setzte er sich mit gekreuzten Beinen neben mich und blieb nachdenklich ruhig sitzen. Ich schloss die Augen und wartete. Ich wartete auf irgendwas – aber ich wusste nicht auf was. Von einer Vergewaltigung hatte ich keine reale Vorstellung – also wartete ich auf den Tod. Ich erwartete ihn in großer Gelassenheit – denn nichts erreichte mich wirklich.
Plötzlich merkte ich, wie der Russe sich über mich beugte. Ich roch ihn ganz deutlich und dann spürte ich seinen Atem an meinem Hals. Auf einmal fühlte ich seine Lippen unendlich sanft auf meinen Lippen und zärtlich fuhr er mit der Spitze seiner Zunge ein klein bisschen dazwischen. Ich erstarrte noch mehr. Was war das? War so der Kuss eines Mannes? Mich hatte noch nie ein Mann geküsst. So war das also! Gelassen nahm ich es hin.
Und stocksteif, Arme und Beine lang ausgestreckt, blieb ich auch liegen, als er mit leichter kundiger Hand unter meinen Rock fuhr – unter meinen Schlüpfer und mit einem Finger in mich hinein. Es tat nicht weh und ging blitzschnell. Ich zuckte nicht zusammen und nahm es gleichgültig hin. Von einem Jungfernhäutchen hatte ich noch nie etwas gehört.
Aber der Mongole war irgendwie ratlos. Er setzte sich wieder neben mich. Er strich mir nur noch beruhigend über das Haar, sonst berührte er mich nicht mehr. Er blieb bewegungslos neben mir sitzen. Nach einiger Zeit gab es vor der Tür Gerufe und Gebrülle. Irgendjemand klopfte und rief etwas auf russisch. Der Mongole stand schnell auf, ergriff seine Waffen, lächelte mir zu und verschwand eilig. Und die ganze Horde mit ihm wie ein Spuk.
Es dauerte ein Weilchen, bis ich ganz benommen
aufstehen konnte. Keiner aus meiner Familie getraute sich in den Keller, in dem
sie mich vermuteten. Weil ich keinen Pips von mir gab, dachten sie bestimmt, die
Russen hätten mich umgebracht.
Meine Familie und die anderen Hausbewohner standen im Gang, als ich aus
dem Keller trat. Alle freuten sich, dass ich lebte. Meine Mutter fragte leise:
»Hat er?« Ich schüttelte meinen Kopf und sie fühlte wohl Erleichterung. Das
war auch schon alles. Es ging nur um Leben oder Tod. Für Gefühlsduselei war
kein Platz mehr.
Wie ich erfuhr, war das schnelle Verschwinden der Russen aus unserem Keller den Russen aus der Fabrik nebenan zu verdanken. Irgendjemand war rüber zu meinen Vater gerannt, der in der Fabrik wie immer die Fleischkühlung hütete. Als mein Vater erfuhr, was sich in unserem Keller abspielte, bat er die ihm bekannten Russen um Hilfe und die kamen angerannt und verjagten die ganze Bande.
Und so war ich noch einmal davongekommen. Was später
noch hätte passieren können, wusste ja kein Mensch. Ich kroch unter meine
Decke und fühlte mich sehr allein. Es wäre schön gewesen, nicht mehr in mich
zurückkehren zu müssen, denn dann würde ich das Elend um mich herum
vielleicht nicht sehen. Nicht so genau.
27.April
Es war der 27.April. Das weiß ich ganz genau, weil
ich ihn mein ganzes Leben nie vergessen habe. Ich stand mit meinen Schwestern an
einem kleinen Fenster eines Nebenkellerraumes, der dem Triftweg zugewandt war.
Es war zwar zugenagelt, aber ein kleiner Spalt zum Hindurchspähen war
geblieben. Leider versperrte uns die niedrige Mauer vor unserem Haus eine gute
Sicht. Jedoch für uns Kellerasseln war es schon viel, was wir sehen konnten.
Ströme von Soldaten mit Kriegsgerät zogen an unserer Kriegerheimsiedlung
entlang. Dazwischen elende Flüchtlingsgestalten, die ihre Habe in Koffern,
Taschen und Rucksäcken mühsam vorwärts schleppten. Wer einen Handwagen besaß,
war etwa besser dran. Auf der voll bepackten Karre huckte oft noch ein total übermüdetes
oder krankes Kind, manchmal auch ein fast zu Tode erschöpfter alter Mensch.
Alle wollten den Triftweg hoch, nach Rummelsburg. Heute führt annähernd die
Sewanstraße dort hin. Aus der Innenstadt hörten wir das Gedonnere der schweren
Kampfhandlungen. Bei uns hatte der nahe Lärm der Geschütze aufgehört. Wir
lagen ziemlich weit hinter der Kampflinie. Vor Bombenabwürfen brauchten wir uns
nicht mehr zu fürchten. Die Stalinorgel orgelte auch nicht mehr. Sie war
weiter gezogen, orgelte jetzt woanders.
Mit Wehmut sahen wir ein Stückchen Himmel an. Gisela fragte leise: »Ob
wir jemals wieder aus diesem Keller rauskommen?« Wir schwiegen. Wir wussten es
nicht.
Oft kam Palo, um nach uns zu sehen oder uns etwas zu bringen. Heute
brachte er Brot, dass die Italiener in der Fabrik versucht hatten, selbst zu
backen. Es hatte wenig Ähnlichkeit mit Brot, weil sie noch keine Hefe und
keinen Sauerteig organisieren konnten. Brot war so kostbar. Wir hatten schon
ziemlich lange keins mehr. Lächelnd übereicht er es mir. Er lächelte mich
immer an. Dankbar biss ich hinein. Alles wurde redlich geteilt. Auch die Kinder
mümmelten drauf herum. Ich verstand gar nicht, was die Männer plötzlich alle
von mir wollten.
Bloß gut, dass wir das Klo und das winzige Waschbecken in dem kleinen schmalen Keller neben der Waschküche hatten. Das Wasser rieselte nur spärlich, aber wir waren besser dran, als fast alle anderen Berliner, die gar keins hatten.
Wir nahmen an, dass es an der Fabrik lag, die mit
Fleischvorräten voll bepackt war und die Russen es durchgesetzt hatten, dass sie
mit Wasser und Strom versorgt wurde – und wir glücklicherweise an ihrer
Wasserzufuhr hingen. Dadurch konnten wir ein Minimum von Reinlichkeit genießen.
Gestunken haben wir trotzdem, denn Seife gab es schon lange nicht mehr.
Mein Vater kam so oft wie es ging zu uns. Sehr oft gelang es ihm nicht,
sich aus der Fabrik loszureißen – und wenn er bei uns war, hütete er unsere
Haustür an der Stelle von Herrn Walter, um die Russen abzuwimmeln. Eigentlich
habe ich ihn in dieser Zeit nie schlafen gesehen. Drüben in der Fabrik musste
er mit dem Kapitän immer noch jeden Tag Brot und Speck essen und dazu Wodka aus
Wassergläsern trinken. Wenn er mal bei uns war und die Russen aus der Fabrik
ihn brauchten, kamen sie ihn holen. Dann mussten sie auch an unsere Haustür
donnern. Ehe mein Vater öffnete, wurde ich immer erst versteckt. Keiner sollte
mich sehen dürfen.
Irgendwann an diesem Tag schlug ein Trupp fast unsere Haustüre ein. Wir spürten es sofort: Die waren noch schlimmer als die anderen. Wir Frauen rotteten uns wie immer mit den Kindern zusammen, als wenn uns das wirklich helfen könnte. Unsagbare Angst breitete sich immer aus. Ich kroch tiefer in meine dunkle Ecke. Zufällig war mein Vater da – das beruhigte uns etwas. Aber als er der fremden Horde die Tür aufmachte, bohrte ihm gleich der erste Russe die Maschinenpistole in den Bauch und drückte ihn damit an die Wand. Mein Vater fiel also schon mal aus. Herrn Walter erging es nicht anders. Alle Russen wussten, dass die Bevölkerung Berlins in den Kellern hauste – also kamen sie sofort, laute Befehle und Drohungen brüllend, die Treppe zu uns herunter. Wir waren vor Furcht fast zu Salzsäulen erstarrt. Es waren große starke freche Kerle, keine Asiaten. Sie hätten gute SS-Männer abgegeben. Herrisch standen sie uns gegenüber, stöberten oberflächlich im Raum herum. Als sie meinen kleinen Hund entdeckten, lachte einer laut, zog sein Gewehr, zielte auf ihn und sagte: »Peng, peng!« Aber er erschoss ihn nicht.
Ein Russe entdeckte mich. Mit einem Begeisterungsruf zottelte er mich hervor und zog mich aus dem Keller. Mir ist es so in der Erinnerung, als höre ich meine Mutter und meine Schwester protestierend aufschreien.
Von Anfang an war etwas anders als gestern. Es lag so absolute Bösartigkeit in der Luft. Der Russe stieß mich die Kellertreppe hoch, hielt mich mit eiserner Hand fest. Wieder musste ich an hämisch grinsenden Gesichtern vorbei – und dann stand da mein Vater an der Wand. Die Tränen liefen ihm die Wangen herunter. Er flüsterte leise: »Mäuschen«. Man stieß mich an ihm vorbei. Ich verstand die Welt nicht mehr. Warum tat er nichts? Er ließ mich gehen? Ich hatte doch immer darauf vertraut, dass er mir in allen Situationen helfen würde. Und nun stand er da und tat nichts. Meine Vorstellung vom Leben, von der Liebe meines Vaters brach blitzartig zusammen, denn ich war noch sehr jung – und noch sehr dumm.
Der Russe drängelte mich die Treppe hoch, die zu den Wohnungen führte. In mir rastete etwas aus. Ich spürte, es geht zur Sache – ich würde nicht so glimpflich davonkommen wie gestern mit dem Mongolen. Heute wusste ich genau, um was es ging, ich war aufgewacht und hatte nicht mehr die Nervenkraft, ruhig zu bleiben. Vor Angst gebärdete ich mich im Gegensatz zu gestern wie eine Irrsinnige. Ich schrie und strampelte, biss und kratzte, wehrte mich mit Händen und Füßen. Ich ahnte ja nicht, dass er zu der Sorte von Männern gehörte, denen so ein Spektakel gerade gefällt. Er schnappte mich dröhnend lachend, umfing mich eisern und schleppte mich ab – in das Schlafzimmer meiner Eltern, das rechts Hochparterre lag – und schmiss mich aufs Bett.
Und nun begann wirklich ein Kampf zwischen uns beiden auf Leben und Tod. Es wurde das schlimmste Ereignis meines ganzen Lebens und verfolgt mich bis in die heutigen Tage. Was sich abspielte, wünsche ich keiner anderen Frau. Nicht einmal der, die ich hasse wie die Pest. Weil ich so unerfahren war, wusste ich auch nicht, wie sehr ich mir selbst durch meinen Verteidigungskampf schadete. Ich war gänzlich verkrampft und so konnte der Mistkerl nicht in mich eindringen. Er fluchte fürchterlich und er schüttelte und schlug mich, was mich nur noch verrückter machte. Ich litt wahnsinnige Schmerzen und ich hatte das Gefühl, er will einen Ast in mich hineintreiben. Dann schien ihm das Theater zu reichen. Er legte seine beiden Hände um meinen Hals und versuchte mich zu erwürgen.
Und während ich nach Luft rang und ich das Gefühl hatte, meine Augen wollen aus meinem Kopf quellen, gelang es mir wieder. Ich verließ mich! Es ging mich nichts mehr an. Ich bereitete die Arme seitlich aus und wurde ruhig. Plötzlich konnte ich auch wieder atmen. Ich gab auf. Und so nahm er sich, was er wollte. Mein Schmerzempfinden schien sogar gedämpft zu sein – Ich wurde zu einer Puppe, die mich nicht mehr viel anging.
Es dauerte gar nicht lange und es war vorbei. Er suchte seine Waffen zusammen und sprang aus dem Fenster.
Ich lag blutend und voller Schmerzen auf dem Bett – aber ruhig und gelassen – denn die das alles erlebte, war ja eine ganz andere. Und plötzlich war er wieder da. Ich bekam alles mit, aber ich rührte mich nicht. Er war wohl zurückgekommen, weil er sein großes Messer vergessen hatte. Er steckte es sich in den Gürtel wie ein Bandit. Als ich merkte, er kommt zu mir, schloss ich die Augen. Er legte sein Ohr auf meine Brust, wohl um zu horchen, ob mein Herz noch schlug. Da machte ich die Augen auf und ich sah ihm direkt ins Gesicht. Er erschrak und wich zurück, denn was ich sah, erfüllte mich mit Hass. Was ich sah, war kein Monster – nein – es war ein ganz normaler gut aussehender Mann. Und das erschreckte mich fürchterlich. Wenn so ein Mann so brutal, so erbarmungslos sein konnte, dann konnte es vielleicht jeder Mann – wenn er die Gelegenheit hat. Dieses Misstrauen begleitet mich seit damals durch mein ganzes Leben. Ich war mir immer der Gefahr bewusst, die von Männern ausgehen kann. Wenn ich mich mit zwei Männern allein in einem Raum aufhielt, fingen in meinen Innern sofort alle Alarmglocken an zu schrillen. Das ist noch heute so.
Der Russe machte sich wieder durch das Fenster
davon. Ich blieb liegen – wie gelähmt – unfähig aufzustehen. Mich
interessierte auch nichts mehr.
Nach, wie es mir vorkam, langer Zeit, ging die Schlafzimmertür ganz langsam und zögerlich einen schmalen Spalt auf. Ilse Walters blasses Gesicht erschien. Sie kam nachsehen, was aus mir geworden war, weil so eine Stille herrschte. Sie fand mich lebend und mit offenen Augen. Ich war wieder ansprechbar und sie redete mit ruhiger Stimme auf mich ein. Im Korridor standen alle anderen – meine Eltern und meine Schwestern. Sie hatten wohl wieder gedacht, ich sei tot. Nein – ich lebte immer noch. Trotz der Verletzungen konnte ich aufstehen und laufen und so ging ich zu den anderen.
Keiner umarmte mich, keiner fragte mich nach etwas,
keiner tröstete mich. Scheinbar war die Welt um uns herum so voll Leid und Tod,
dass das, was mir geschah, im Grunde nicht zählte, denn ich hatte ja überlebt.
Und ich jammerte nicht. Kein Wort der Klage kam über meine Lippen. Keiner
fragte, ob ich verletzt wurde – und darum erfuhr es auch keiner. Man ließ
mich als Fünfzehnjährige vollständig alleine und ohne Hilfe. Noch heute, wenn
ich nachdenke, erschreckt mich die Gefühlskälte meiner Mutter und meiner
Schwestern. Über so ein Thema sprach man in unserer Familie nicht.
Mein Vater und ich gingen uns vorsichtig aus dem Weg. Vor diesem bitteren Ereignis war ich, wie schon einmal gesagt, eine absolute Vater-Tochter gewesen. Er war die große Liebe meines Lebens gewesen. Das war für immer vorbei. Er hat sehr darunter gelitten. Aber ich war aus dem Paradies vertrieben worden. Meine Kindheit hatte ein gewaltsames Ende gefunden. Ich sah in ihm nun nicht mehr den über alles geliebten Papa – ich sah plötzlich, dass er ein ganz normaler Mann war.
Ohne Komplikationen, ohne eine Träne fügte ich
mich wieder in die Kellergemeinschaft ein. Vielleicht war ich auch noch nicht
ganz wieder in mir.
Meine Mutter gab mir eine Schüssel mit Wasser, damit ich mich waschen konnte, nur wenig größer als das kleine Waschbecken im Klo – aber ich konnte mich wenigstens darüber hocken, um mich zu säubern. Aus einem Versteck kramte sie ein winziges klein gewaschenes Stückchen Seife hervor und gab es mir. Das blieb aber auch das einzige Zugeständnis, das sie mir machte. Als ich sagte: »Mutti, ich blute ja so«, antwortete sie nur: »Ja, ja, das ist dann so!« Das war alles. Mit dem anderen hatte ich allein zurecht zu kommen – und ich tat es ja auch; aber es war schwierig – schon alleine deswegen, weil es weder Zellstoff, noch Watte, noch Binden gab. Ich schnitt einer meiner Puppen den Bauch auf, in dem weiche weiße Watte steckte und klaute den Kindern eine saubere Windel. Irgendwie musste ich mich ja versorgen.
Ich glaube, noch an diesem Abend bezogen zwei
russische Offiziere die Wohnung meiner Eltern. Es waren zwei sehr kultivierte,
gebildete Männer und für uns ein Segen, denn sie beschützten uns, soweit es
ihnen möglich war. Wenn sie zu Hause bei uns waren und ein Trupp marodierender
Russen trommelte gegen unsere Haustür, gingen sie sofort ans Fenster,
schimpften und verjagten sie. Wir waren ihnen von Herzen dankbar und schliefen
in dieser Nacht wie Tote.
28.April
Am nächsten Morgen kam Palo. Als er mich irgendwie elend vorfand, trat pures Entsetzen in sein Gesicht, dass wirklich und wahrhaftig blass wurde. Und weil er so eine braune Hautfarbe hatte, sah er richtig grün aus. Er sprach ziemlich gut Deutsch. Zwar nur gebrochen, aber man konnte ihn gut verstehen. Er ging sofort zu meiner Mutter, um sie zu fragen, was geschehenen war. Sie zuckte traurig mit den Schultern. Da geriet Palo außer sich. Tränen stürzten aus seinen Augen. Er drehte sich zur Kellerwand um und bearbeitete sie mit seinen Fäusten. Dann stürzte er davon.
Später, als er wiederkam, erwischte er mich mal
alleine, was ja sonst eigentlich nie vorkam. Er wollte mich tröstend in die
Arme nehmen, aber ich kriegte fast einen hysterischen Anfall. Ich wollte von
keinem Mann mehr in die Arme genommen werden. In seiner komischen Ausdrucksform
sagte er, das, was mir geschehen sei, sei keine Liebe gewesen – nur Gewalt.
Ich sollte ihm glauben, Liebe sei ganz, ganz anders. Ich schrie ihn an, er soll
mich mit der verdammten Liebe in Ruhe lassen. Ich habe von der Liebe die Nase
voll und ich will keine Liebe. Er lächelte zärtlich und sagte: »Ich hätte
deine Liebe aber gern, denn ich liebe dich sehr!« Ich hätte ihn ermorden können.
Von Stund an war ich frech und aufsässig zu ihm und der arme Kerl ertrug es mit
großer Gelassenheit.
Es kam nun immer öfter vor, dass man schnell mal von Haus zu Haus schlüpfte, um zu horchen, wie es in dem Nachbarsleuten so ging, oder um etwas zu bitten. So kam Frau Sack zu meiner Mutter, um ihr von der abenteuerlichen Tour nach Dahme zu berichten.
Sie, die ich schon einmal Mutter Courage nannte, hatte es tatsächlich geschafft, mit ihren zwei Jungs Dahme zu erreichen und Margot heimzuholen. Hin und zurück in wenigen Tagen. Ihr Weg führte sie über Zossen, Baruth und quer durch den niederen Fläming. Sehr oft hatten sich ihrer russische Soldaten erbarmt und sie streckenweise auf Panjewagen mitgenommen. Auf der ganzen abenteuerlichen Reise war ihnen kein Leid geschehen - nur ihre Füße wiesen große blutige Blasen auf. Stellenweise sah man das rohe Fleisch, denn damals besaß kaum ein Mensch passendes Schuhwerk.
Am bedrohlichsten
empfanden sie die Überquerung der Spree an der Edison-Brücke in Schöneweide.
Die hatte die Deutsche Wehrmacht noch schnell gesprengt, ehe sie sich zurückzog.
Über Bretter, Bohlen und zusammengebundene kleine Boote, konnte man sie, wenn
man mutig genug war, überqueren. Und Frau Sack war mutig genug – sogar mit
dem Sportwagen, in dem der kleine zweijährige Werner saß. Alles hatte ein
gutes Ende gefunden und sie badeten und bepflasterten ihre Blasen. Der Vater der
drei Kinder war umgekommen – aber die restliche Familie war wieder zu Hause
vereint.
Natürlich hatte Frau Sack schon gehört, was mit mir geschehen war. Sie
riet meiner Mutter, mich nicht so zu verstecken, sondern im Gegenteil, mich aus
dem Haus auf die Straße zu lassen. Da seien viele Menschen und da würde mir
nichts geschehen. Irgendwie leuchtete das meiner Mutter ein. Frau Sack machte
mir den Vorschlag, sie doch nachmittags zu besuchen. Ich würde meine
Freundinnen wiedersehen, Margot, Margrit usw. denn die würden auch kommen. Außerdem
würden bei ihnen sehr nette russische Soldaten wohnen, ein Offizier mit seinen
Mannen. Der Offizier sprach Deutsch, sie spielten wundervolle russische Lieder,
sangen und es sei sehr gemütlich und völlig harmlos, denn die Soldaten würden
keinem Mädchen etwas zu leide tun. Das hörte sich alles gut an und ich wollte
gerne hingehen. Mein Gott – ich war 15 und doof wie Bohnenstroh – Ja –
meine Mutter erlaubte es mir sogar. Ich freute mich sehr, seit so langer Zeit
mit meinen Freundinnen zusammen zu kommen.
Zur verabredeten Zeit verließ ich unser Haus und rannte zu Sacks rüber, zwei Hauseingänge weiter, nur einen Katzensprung entfernt – aber Welten lagen dazwischen. Keiner hütete die Haustür wie bei uns. Ich konnte klingeln wie früher. Schon im Hausflur hörte ich die Töne einer Balalaika. Ein einziger Russe sang mit tiefer schöner Stimme ein schwermütiges Lied. Lieder haben ja die Russen ...das muss man ihnen lassen. Alle freuten sich, als ich ins Wohnzimmer trat. Ich war überrascht. Der große Tisch und die Stühle standen nicht mehr da. So war ein freier Platz entstanden, auf dem alle auf dem Fußboden im Kreise saßen. Auf einer Seite die Frauen und Mädchen, auf der anderen Seite die Soldaten mit etlichen Musikinstrumenten. Ich setzte mich zwischen die Mädchen – nicht im Schneidersitz, sondern auf meine Hacken.
Es ging sehr lustig und sehr anständig zu. Es gab nichts, worüber man hätte klagen können. Die Russen tranken zwar Wodka, aber die Frauen und Mädchen bekamen keinen angeboten. Wir bekamen schwarzen Tee in Gläsern. Kein Russe benahm sich daneben – nur die ganze Situation wirkte fremdländisch; etwas asiatisches lag in der Luft. Der Offizier schien auch ein Asiat zu sein. Auf alle Fälle ein Halber. Trotz seiner Glatze war er ein gut aussehender Mann. An seiner gepflegten Uniform klimperten viele Orden und in seinen weichen blank gewichsten Stiefeln aus weichem Leder spiegelte sich das Licht. Er schien der absolute Herr und Anführer zu sein. Man redete mir zu, doch endlich meinen Mantel auszuziehen. Nun gut, es war doch so gemütlich und ich wollte noch ein Weilchen bleiben. Der Offizier wurde aufmerksam. Was ich da aus meinem Mantel pellte, schien ihn zu interessieren. Immer länger ruhte sein Blick auf mir. Dann bot er mir als einziger eine Zigarette an. Nein danke, ich rauchte nicht – dann einen Fingerhut Wodka. Nein danke, ich trank nicht. Ich dachte schon, er würde nun böse werden, aber das Gegenteil war der Fall. Meine Ablehnungen schienen ihm sehr zu gefallen. Mir wurde die ganze Sache etwas unheimlich. Meine Freundinnen guckten schon komisch und stießen sich viel sagend an. Als die Soldaten bemerkten, dass ich die Favoritin des Kahlköpfigen zu sein schien, ruhten ihre Augen oft und mit Wohlgefallen auf mir.
Ich bekam Angst. Ging es schon wieder los? Was hatte ich den Männern getan, dass sie mir so weh tun wollten. Ich wollte lieber wieder in meine Schule gehen – mit meinen Freundinnen ins Kino – mit ihnen lachen, erzählen und Schlager singen. Von Männern wollte ich nichts. Ich wollte nie in meinem Leben mehr einen Mann lieben.
In meiner Ahnungslosigkeit der Unaufgeklärtheit wusste ich zwar, dass Männer und Frauen zusammen ins Bett gehen, um Kinder zu machen und wie die auf die Welt kommen, wusste ich auch, denn das hatte ich von fast genauso dummen Freundinnen in heimlichen Gesprächen erfahren – aber ich wusste nichts von Liebe, von Trieben, von Sexualität, von Gier und von brutalen Spielarten, nichts von Lust und Leidenschaft. Richtige Panik fing an in mir hochzusteigen.
Ich sagte also, ich müsse leider nach Hause gehen – und wollte aufstehen. Aber der Glatzköpfige protestierte. Er rief laut: »Niet, niet« und er habe mir noch etwas wichtiges zu sagen. In seinem seltsamen Deutsch sagte er, ich gefalle ihm und er bitte mich, so lange es geht, seine Frau zu sein. Er würde mir ein schönes Leben bereiten und ich brauche keine Angst mehr vor russischen Soldaten zu haben. Er würde mich vor allen anderen beschützen, aber ich dürfe nur ihn lieben – ihn allein. Und für mich wäre das doch viel besser, wenn ich nur ihn hätte, als wenn ich jeden Tag von einem anderen genommen werde.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte – also sagte ich überhaupt nichts. Ich war so verzweifelt, ich stand auf und wollte fortrennen. Der Glatzköpfige rief: »Stoi – so geht das nicht mehr«. Ich stehe nun unter seinem Schutz und bei diesem momentanen Chaos lasse er mich nicht alleine auf die Straße gehen, ein Kamerad von ihm würde mich heimbringen. Verdattert trottete ich neben dem her. Wir sprachen keinen Ton miteinander. Ein ganz einfacher Soldat schien das auch nicht zu sein. Er war der schönste Mann, den ich jemals gesehen habe. Dass ließ mich aber kalt, denn ich wusste aus bitterer Erfahrung, dass auch ein schöner Mann ein Monster sein konnte. Bei unserer Haustür angekommen, drückte ich vorsichtshalber auch noch auf die Klingel unserer Wohnung, der Russe bummerte gegen die Tür. Es wurde geöffnet und oben auf dem Podest standen die beiden Offiziere, die in unserer Wohnung wohnten und die machten auf der Stelle einen wahnsinnig lauten Zirkus mit dem Russen, der mich gebracht hatte. Der verteidigte sich auch laut, aber schließlich entfernte er sich. Einer der Offiziere legte mir schützend einen Arm um die Schultern und übergab mich wortlos meiner Mutter, die sich bedankte.
Was sich abgespielt hatte, wollte niemand wissen. Ich hatte ja überlebt und das war die Hauptsache. Jeder war bestimmt so sehr mit seinen eigenen Nöten beschäftigt, dass er für die Nöte anderer keinen Sinn mehr hatte.
Ich blieb von dem Glatzkopf fortan unbehelligt. Er
blieb mit seinen Mannen aber längere Zeit wohnen.
Ich kroch unter meine Decke in der dunklen Ecke. Am liebsten wäre ich nie wieder hervorgekommen. Ich war verzweifelt und so alleine. Ich schämte mich so sehr. Was machte ich falsch, dass nur mir das alles passierte und keiner sprach mit mir darüber. Ich wollte das, was mir geschah doch gar nicht. Warum machte ich meiner Mutter so viel Kummer? Sie hatte geweint und gesagt, sie kann nicht mehr und sie halte das alles nicht mehr aus.
Palo kam vorbei und brachte uns zu essen. Ich
wollte nichts essen. Er kam zu mir in die dunkle Ecke und strich mir mit der Rückseite
seiner Hand ganz leise und vorsichtig über meine Wange. Da musste ich weinen.
–
29.April
Der 29.April 1945 war ein wundervoller Tag wie Samt und Seide. Es war mir so sehr zuwider im dunklen Keller zu hucken – ich wollte so gerne hinaus an die frische Luft, den Himmel und die Sonne sehen
Eine Nachbarin, Frau Radelhof, kam zu uns herüber und sagte, in Karlshorst bei dem einen Bäcker solle es Brot geben, er backe wieder. Ich quälte meine Mutter so lange, bis sie mir erlaubte, mit Ilse Walter nach Karlshorst zu laufen, um dem Gerücht nachzugehen. Brot war ein Zauberwort, bei dem sogar meine Mutter schwach geworden war. Wir sehnten uns alle nach einem richtigen Stück frischem Brot. Also trabte ich vergnügt mit Ilse Walter los. Wir hatten in der Nacht unter der Obhut der Offiziere gut geschlafen und mir ging es besser – ich konnte wieder richtig laufen und tat es mit Freude an dem schönen Frühlingstag.
Überall sah es schrecklich aus. Am meisten ängstigten mich die 4 riesigen ausgebrannten Panzer in der Nähe unserer Bunker. Überall Russen, fremdländisch anzusehen. Kolonnen gefangener deutscher Soldaten, Flüchtlinge über Flüchtlinge – es war das gewohnte Chaos. Ich sah es schon gar nicht mehr. Es gehörte schon lange zu meinem Leben.
Auf der Treskowallee bei der Marksburgstraße sahen wir plötzlich einen Russen mit seiner Maschinenpistole im Arm und daneben einen Zivilisten, die Personenkontrolle machten. Ohne Ausweis war man so gut wie verloren – aber wir hatten unsere ja dabei. Schon von weitem bemerke ich, dass er mich anstarrte und auf mich wartete. Ich wusste sofort, dass zurück rennen nichts bringen würde. Es war viel zu weit nach Hause – und er würde schneller sein. Wie ein hypnotisiertes Kaninchen lief ich weiter und damit auf ihn zu. Er deutete mit seiner Waffe rüber auf die andere Straßenseite der Treskowallee und der in Zivil, der mir bekannt vorkam, sagte in gebrochenem Deutsch, wir sollen dort rüber gehen und warten. Also ging ich mit Ilse rüber. Wir warteten aber nicht, sondern liefen schnurstracks zurück in die Richtung unseres Zuhauses, in der Hoffnung, er würde es durch seine Kontrolliererei nicht beobachten können. Er sah es aber sofort und brüllte »Stoi«, kam wie ein Verrückter über die Treskowallee gerannt, riss mich von Ilse weg und zerrte mich in das Eckhaus Marksburgstraße, in dem ein Kaffee war. Der Zivilist kam auch dazu und Ilse konnte mir nur noch zurufen: »Ich laufe zum Kommandanten, der residiert hier in der Nähe und soll prima sein!«
Mir sträubten sich vor Entsetzen die Haare. Ich registrierte noch, dass ich den in Zivil vom Sehen kannte. Es war ein so genannter Fremdarbeiter und ich glaubte zu wissen, dass er in dem eingerichteten Lager im ehemaligen Gartenlokal »Steiers Waldschloss« wohnte – oder gewohnt hatte. Zur Nazizeit jedenfalls. Ich protestierte laut, aber keiner kam mir zu Hilfe. Sie zottelten mich in das leere Kaffee und bugsierten mich gemeinsam durch eine Luke die Kellertreppe hinunter und machten die Klappe hinter sich zu. Ein ganz kleines Fenster spendete wenigstens einen Grauschleier in die Düsternis.
Abwechselnd vergewaltigten sie mich, ließen mich danach liegen und verließen mich. Die Luke sperrten sie zu. Ich wollte so gerne ausrücken, aber es war unmöglich, das Fenster war viel zu klein. Verzweifelnd und vor Schmerzen wimmernd lag ich auf dem dreckigen Kellerboden. Ich hatte wieder einmal Todesangst. Was würde aus mir hier im Kellerloch werden? Nach einer ganzen Weile kamen die beiden wieder und vergewaltigten mich aufs neue abwechselnd.
Leider gelang es mir nicht mehr, mich zu verlassen. Ich gab mir wirklich große Mühe, aber es klappte nicht – so musste ich alles mit klaren Sinnen über mich ergehen lassen.
Irgendwann verschwand der Ost-Arbeiter. Vielleicht war auch der Russe meiner satt, denn er zerrte mich die Treppe wieder rauf. In dem Moment ging die Tür auf und mein Vater und Palo kamen herein. Wie sich das im Einzelnen nun abspielte, weiß ich nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Palo wollte dem Russen an die Gurgel, aber der mit seiner Maschinenpistole war natürlich im Vorteil. Er zwang mich, ihm die Hand zu geben, dass weiß ich noch. Irgendwann war ich dann mit meinem Vater und Palo wieder draußen auf der Straße. Da stand auch mein Buddelkastenfreund Wölfchen. Palo sagte, ich solle mich auf die Fahrradstange setzen und er würde mich ganz schnell nach Hause fahren. Ich lehnte ab – aus zweierlei Gründen. Erstens hätte ich auf der Eisenstange vor Schmerzen nicht sitzen können – und zweitens wäre ich zu eng mit Palo in Berührung gekommen. Ich wollte keinen Körper eines Mannes so nahe spüren. Also liefen wir vier sprachlos nach Hause. Keinem von uns fiel ein Wort ein, dass er hätte sagen können.
Als wir endlich zu Hause ankamen, gerieten wir auf
der Kellertreppe in ein Chaos. Alle waren um meine Mutter versammelt, die am
Ausrasten war. Sie hatte einen Strick an die Brust gedrückt und war im Begriff
gewesen, sich aufzuhängen.
Alle kümmerten sich nun um meine Mutter, die immer schrie, sie halte das
nicht mehr aus, sie werde noch wahnsinnig und sie wolle nicht mehr leben. Das
ich lebte, dass war ja sichtbar und damit hatte es sich! Nie im ganzen Leben hat
mich jemand aus meiner Familie gefragt, was ich erlebt hatte. Ich kroch in meine
Ecke, zog die Decke über meinen Kopf und weinte leise, ohne dass es jemand hörte.
Alle trösteten meine Mutter – wer sollte mich da auch hören?
30.April
Am nächsten Tag verweigerte mein verzweifelter Vater den Russen in der Fleischwarenfabrik den Dienst. Er sagte zum Kapitän, er müsse zum Schutz seiner Familie zu Hause sein. Er erzählte, wie es mir ergangen war – und so gehe es einfach nicht weiter. Der Kapitän hatte Verständnis, aber er konnte auf keinen Fall auf meinen Vater verzichten. Er war der einzige Kühlfachmann, also sagte er, mein Vater solle seine Familie in die eine leer stehende Wohnung der Fleischfabrik bringen und sie somit unter die Bewachung und den Schutz seiner Wenigkeit und seiner Soldaten stellen. Mein Vater sagte zu.
Palo kam mit etlichen seiner Kameraden, um unsere
wichtigsten Klamotten, wie Decken, Betten, Koffer und Kinderkram rüber in die
Fabrik zu schleppen. Die Italiener hatten schon Matratzen für uns ausgelegt und
versorgten uns mit Essen. Es folgten zwei Tage der Ruhe.
Dann auf einmal gab es einen wahnsinnigen Tumult. Palo kam mit seinen Kameraden und half uns, unser Gepäck schnellstens aus der Fabrik wieder zurück in unseren Keller zu bringen. Das hatte seinen Grund. Der alte nette Kapitän war abgelöst worden und der Neue nahm sich nach und nach die Frauen vor, die in der Fabrik lebten. Also – nichts wie weg.
Nun saßen wir verschreckt, verzweifelt und
eingeschüchtert wieder im Dunkeln. Aber nicht lange! Leider – oder Gott sei
dank, verließen uns die beiden Offiziere und unsere Wohnung war für uns wieder
frei. Bombardierungen und Beschuss fürchteten wir nicht mehr. Es tobte in der
Innenstadt noch immer weiter, aber bei uns war es ziemlich ruhig. In unseren Gärten
grasten friedlich die Pferde der bespannten Nachhut. Palo organisierte zu
unserem Schutz etwas anderes. Mehrere seiner Kameraden arbeiteten praktisch Tag
und Nacht in unserer Küche. Wir hatten zwei Herde zu stehen: Einen Kohleherd
mit Backofen und einen Gasherd – auch mit Backofen. Nun wurde von den
Italienern Brot gebacken. Es schmeckte und kaute sich jetzt schon besser und um
Brot brauchten wir uns keine Sorgen mehr machen – sie versorgten uns täglich
frisch – dass veranlasste Palo schon. Wir zogen endlich aus dem Keller und
lebten unter dem Schutz der Italiener – unseren anderen ehemaligen Feinden.
Wir kamen uns vor wie im Himmel und konnten uns auf die 2½ Zimmer verteilen. Unser Aussehen glich Gespenstern. Eines Tages brachte mir Palo ein duftendes rosa Stückchen Seife. Das folgende erste Bad in einer Pfütze von lauwarmen Wasser mit diesem Stückchen Seife, ist mir unvergesslich geblieben. Von da an liebte ich alle Rosenseifen. Herr Walter konnte seinen Posten an der Haustür aufgeben. Das Marodieren der Rotarmisten ließ langsam nach. Und wenn ein Trupp kam, machten die Italiener ein temperamentvoll noch lauteres Theater – dann verzogen sich die Russen.
Palo verbrachte jede freie Minute, die er erübrigen
konnte, bei uns. Er ließ mich keinen Schritt aus dem Haus mehr allein tun und
ich hatte auch kein Bedürfnis.
Auf den Straßen schien sowieso der Teufel los zu sein. Unsere ganze
Gegend glich einem Hexenkessel. Wie ein Riesenbienenschwarm, der seinen Stock
verlässt, strömten unglückliche Frauen, Kinder, Alte, Kranke, mit dem was sie
tragen konnten, aus Karlshorst heraus. Die Rote Armee hatte sie kurzerhand aus
ihren Häusern und Wohnungen vertrieben, um selbst einzuziehen. Viel durften die
Unglücklichen nicht mitnehmen – fast alles mussten sie zurücklassen – in
wenigen Stunden hatten sie ihre Häuser zu verlassen. Nun irrten sie in der
total überfüllten Stadt umher und suchten nach einer neuen Bleibe. Die Russen
zäunten das beschlagnahmte Gebiet ein und erklärten es zum Sperrgebiet. Später,
als sich vieles wieder normalisierte und auch die Straßenbahn wieder fuhr,
ratterte sie auf der Treskowallee, ohne anzuhalten, durch das Sperrgebiet
hindurch. Zögerlich gaben die Russen kleine Teile wieder zurück, aber endgültig
alles räumten sie erst, als die Rote Armee aus Deutschland abzog.
Ich schloss mich etwas an Ilse Walter an. Meine Schwestern mochten sie nicht – aber ich sie sehr. Man kann sich nicht aussuchen, wen man mag. Entweder man hat jemanden gerne- oder nicht. Ilse mochte mich auch sehr- trotz des Altersunterschiedes. Sie hatte das Alter meiner Schwestern. Sie kam manchmal, um nach mir zu sehen und um ein paar Worte mit mir zu wechseln. Manchmal besuchte ich sie oben im II. Stock unseres Hauses in ihrem Stübchen. Sie hatte herrlich viele Bücher. Sie war die Einzige, die meine Ratlosigkeit erkannte. Sie begriff, dass ich nicht begriffen hatte, was mir geschehen war und warum. Eines Tages gab sie mir Sexualkundeunterricht. Sie erklärte mir die Körper von Mann und Frau. Sie erzählte mir, dass der Penis des Mannes ein Schwellkörper ist, dass Menschen oft von Verlangen und Triebhaftigkeit gesteuert werden und dass Vergewaltigung der Frauen zur Rache der Feinde gehört usw. Das alles hatte ich nicht gewusst. Vieles wurde mir verständlicher- aber ich verstand es für mich selbst nicht.
Ja, man hatte mich vergewaltigt – man hatte mir Gewalt angetan. Aber keine Sekunde habe ich mich geschändet gefühlt, denn Schande haben meine Vergewaltiger über sich selbst gebracht!
Keine Sekunde habe ich mich entehrt gefühlt, denn die Männer, die mich vergewaltigten, haben vor mir ihre Ehre verloren.
Trotz der brutalen Entjungferung habe ich nicht meine Unschuld verloren. Später, wenn auch erst nach Jahren, ging ich unschuldig wie ein junges Mädchen in meine erste Liebeserfahrung, die mir mit Geduld und Zärtlichkeit so ganz anders begegnete.
Die Mistkerle hatten mir Schreckliches angetan –
aber zwei andere Männer hatten um mich geweint: Mein Vater und Palo – aber
keine Frau! Oder ich sah es nur nicht? In den Arm genommen hat mich jedenfalls
keine!
In der damaligen Zeit lebten die meisten Menschen in einem wahnsinnig verklemmten Zustand. Zu denen gehörte leider auch meine Familie. Über die untere Hälfte des menschlichen Körpers sprach man einfach nicht. Kolle kam erst Jahre später.
Nach den Vergewaltigungen halfen mir weder meine Mutter, noch meine Schwestern aus meiner Not und Einsamkeit heraus.
Im Großen und Ganzen beurteile ich unser damaliges Familienleben als sehr gut. Wir hielten fest zusammen und jeder half dem anderen. Ich fühlte mich überaus geborgen – bis sie an mir versagten.
Von da an wusste ich, dass ich ein Einzelwesen war
– und alleine. Die gewaltsame Vertreibung aus der Kindheit hatte endgültig
stattgefunden.
Zu meinem Vater fand ich aus unerklärlichen Gründen nie mehr in das
alte glückliche, vertraute und liebevolle Verhältnis zurück. Er fing an zu
trinken und veränderte dadurch sein Wesen. Dann fing er auch noch
Weibergeschichten an und ich erkannte ihn nicht mehr. Er war für mich so gut
wie verloren.
Am 30.April nahm sich Adolf Hitler das Leben. Wir registrierten es kaum,
für uns war er sowieso schon tot. Es sprach sich herum wie ein Lauffeuer. Ja,
alle waren erleichtert und wir gönnten ihm sein schmähliches feiges Ende. Im
Grunde hatten wir genug mit uns selbst zu tun.
Am 2.Mai kapitulierten die deutschen Soldaten in Berlin. Auch das nahmen
wir nur verschwommen war. Für uns war der Krieg schon längere Zeit aus. Wir
lebten mitten in einem anderen Kampf; dem Kampf ums Überleben. Wir alle standen
durch das Erlebte unter einer Art Schock – wir mussten erst wieder zu uns
selber finden, hatten zu tun, alles zu verdauen.
Große politische Ereignisse erreichten uns nur gedämpft. Bei der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht in der Nacht vom 8. zum 9.Mai 1945 – da war es schon etwas anders.
Der verdammte Krieg war aus! Das ging alles unter die Haut! Dass die Kapitulationsurkunde in Karlshorst in der ehemaligen Pionierkaserne unterzeichnet worden war, weil die Rote Armee dort ihr Hauptquartier eingerichtet hatte, erfuhren wir erst viel später. Heute befindet sich in dem ehemaligen Kasino für Offiziere das Karlshorst-Museum. Der große Saal, in dem das Ereignis stattfand, ist weitgehend im damaligen Zustand erhalten worden und kann besichtigt werden.
Im Nu sprach sich herum, dass Frieden war. Es gab weder Radio noch Zeitungen, aber jeder erfuhr es.
Ich hörte kein Jubeln. Dazu war keiner mehr fähig,
aber alle stöhnten erleichtert »Gott sei Dank«.
Die Rote Armee feierte tagelang – was man ihr nicht verdenken konnte. Überall erklang Musik, die Soldaten tanzten und sangen ihre schwermütigen Lieder.
Wir verbarrikadierten uns um so fester und waren wachsam – aber die Übergriffe ließen nach – und da merkten wir auf einmal - »Tatsächlich« - wir haben überlebt: Es geht weiter!