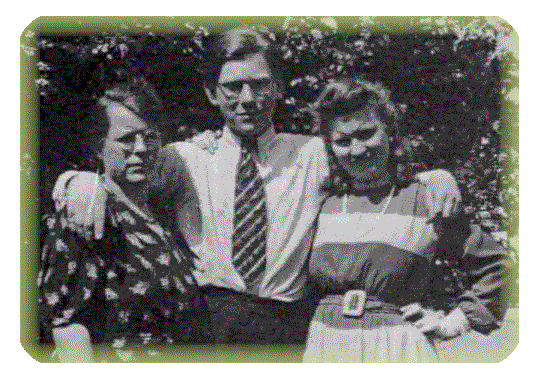
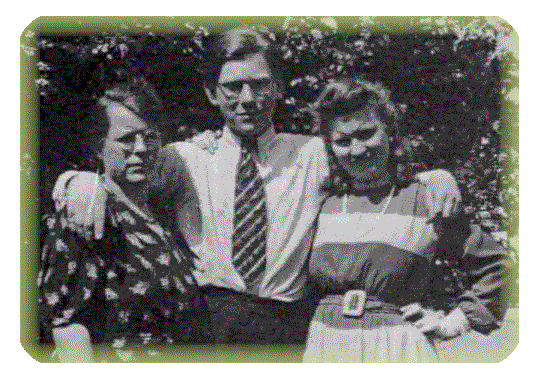
Weiß Du was von Günter? (nach 1945)
Gott sei Dank! Den verdammten Krieg mit den schrecklichen, nervtötenden Bombenangriffen hatten wir überstanden - den Kampf um Berlin, den Einmarsch und den Siegestaumel der Roten Armee ebenso. Aber noch Wochen nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht, am 8.Mai 1945 in Karlshorst, ging es ums reine Überleben. Wir lebten noch immer in einem Chaos. Unsere Welt war total verändert - geradezu auf den Kopf gestellt. All unser Denken war nur bis zum eventuellen Ende des Krieges gegangen. Das Danach hatte jenseits aller Vorstellungskraft gelegen.
Nun hatten wir überlebt und konnten nicht aufhören uns zu wundern, das geschafft zu haben. Jetzt steckten wir mittendrin im Schlammassel der verwüsteten Welt, mußten uns zurechtfinden und durchschlagen. Diese Wirrnis und Zerstörung ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Überall standen ausgebrannte Panzer, demoliertes Kriegsgerät, umgestürzte Straßenbahnen und kaputte Autos. Die Häuser lagen in Trümmern oder trugen Wunden der Einschüsse. Die Erde war aufgewühlt durch Bombentrichter oder lag zu Panzersperren hoch aufgetürmt, welches sich als vollkommener Blödsinn herausgestellt hatte. Die Bürgersteige glichen Berg und Tal. Alles war zerschossen, durcheinander, verwüstet und vermistet.
Unsere Umgebung glich einem Heerlager und erinnerte durch die Fremdartigkeit der Roten Armee an den Einzug der Truppen von Dschingis Chan. Alle asiatischen Stämme aus den weiten russischen Steppen schienen sich bei uns mit Mongolen, Sibiriern, Ukrainern, Weißrussen und Kosaken ein Stelldichein zu geben. Da standen vorsintflutliche Pferdegespanne neben modernen Geschützen, ganz niedrige Transportfahrzeuge, die von Hunden gezogen wurden, neben amerikanischen Lastern. Sogar Kamele, die Kanonen zogen, schaukelten unseren Triftweg hoch nach Rummelsburg. In dem Durcheinander unserer Gärten, die zur Kriegerheimsiedlung gehörten, grasten kleine zottige Panjepferdchen neben edlen Reitpferden. In offenen Kutschen fuhren elegante Offiziere umher und zugleich hockten einfache schlecht gekleidete und geschundene russische Soldaten mit pockennarbigen Gesichtern auf der blanken Erde und erholten sich eine kurze Pause lang von der Last des Soldatenlebens. Unerschöpflich schien der Strom der russischen Armee zu sein, die sich bei uns niederließ. Dazu kamen Tausende von Flüchtlingen, die mit hoch bepackten Hand- oder Kinderwagen, müde, verzweifelt und verstört umherzogen und eine Bleibe suchten. Über die Durchgangsstraße Treskowallee zogen nicht abreißende Kolonnen von Menschen und Vieh.
Auf den meisten Kreuzungen standen barsche unfreundliche russische Soldatinnen in braunen Uniformen, hielten Fähnchen in den Händen und dirigierten die Karawanen. Heimlich betitelten wir sie als Flintenweiber. Sie erregten allgemein schmunzelnde Aufmerksamkeit. Sie hatten so sonderbar vorstehende Brüste. Die Form ihrer Büstenhalter muß total anders gewesen sein als unsere.
Wer glaubt, wir wären durch die Schwere der Zeit gebrochene Kreaturen gewesen, ist auf dem Holzweg - der irrt gewaltig. Nie blühte uns ein Fliederstrauch herrlicher als im Frühling 1945. Nie wieder erschien uns sein Duft berauschender als damals, denn nun kannten wir alle den Gestank der Verwesung. Nie schmeckte eine Scheibe trockenes Brot köstlicher, denn der Hunger war uns nicht mehr fremd. Nie wieder freuten wir uns so herzlich und ehrlich, wenn wir einen Freund trafen, der wie wir überlebt hatte. Nie mehr schmeckte ein Wein, aus einem Versteck gebuddelt, so süß. Alle Gefühle empfanden wir intensiver - die Freude und auch den Schmerz.
Wir liefen nicht mit sauertöpfischen Minen herum, denn jeder hatte gewaltig viel zu tun und da blieb nicht viel Zeit um Trübsal zu blasen. Der Alltag mußte bewältigt werden.
Da es uns gelungen war, die Diktatur des Dritten Reiches zu überleben, schöpften wir, der augenblicklichen Situation zum Trotz, neuen Mut und wagten ganz, ganz vorsichtig von Erleichterungen - von besseren Zeiten zu träumen. Die meisten glaubten, das Schlimmste sei überstanden. Für viele traf das auch zu - für andere leider nicht; aber davon hatten sie noch keine Ahnung. Wir bemerkten überhaupt nicht, daß uns die nächste Diktatur schon im Genick saß und sich fest biß.
Wir mußten essen - aber es gab fast nichts. Wer es nicht verstand zu schieben, zu tauschen, zu organisieren - oder gar zu klauen, war ein armer Hund mit geringen Überlebenschancen. Eine große Portion bürgerlichen Anstands mußte man über Bord werfen, sonst ging man unter. Nur mit Anstand funktionierte nichts mehr. Wenn man überleben wollte, mußte man sich Beziehungen schaffen, wie man das damals so nannte. Man sagte nicht: "Ich kann eventuell dieses oder jenes besorgen, vielleicht Brot oder Zucker", sondern man sagte: "Ich habe Beziehungen zu Brot oder Zucker."
Es bleibt ein Rätsel, daß so viele die Zeit überlebten. Ich denke besonders an alte Leute, Kranke und an die Mütter mit Kindern - manchmal sogar mit mehreren kleinen Kindern. Das muß ein Weinen gewesen sein.
Meine Familie konnte sich glücklich schätzen, weil ein gesunder Mann, mein Vater, bei uns war. Wir lebten durch ihn besser als viele andere und viele lebten von uns und vielleicht sogar durch uns. Mein Vater verstand es aus dem Effeff, uns alle durchzubringen. Der Not gehorchend, wie man so schön sagt, lebten meine zwei verheirateten Schwestern mit ihren Kindern bei uns. Meine Schwester Eva, deren Mann in Italien gefallen war, hatte mit ihrem kleinen Sohn aus Forst flüchten müssen und bei uns Aufnahme gefunden. Genau wie meine Schwester Gisela mit zwei Kindern, deren Wohnung in der Seestraße ausgebombt war. Ihr Mann war irgendwo in Gefangenschaft geraten. In unserer 2½ Zimmerwohnung gab es ein ganz schönes Gedränge. Der Hunger bestimmte das Leben und soweit es niemanden wehtat, warf auch mein Vater seine gute Erziehung über den Haufen. Wer wie er, in einer Tag und Nacht produzierenden Fleischfabrik arbeitete und seine Familie hungern ließ, hätte ein Idiot sein müssen. Mein Vater war keiner.
Für seinen großen Arbeitseinsatz bekam er von dem russischen Kapitän, dem neu eingesetzten Herrn der Fabrik, den alten hatte man einfach zum Teufel gejagt, ein Deputat, wie man das damals nannte, das aus Naturalien bestand. Und wenn man ihn vergaß, dann klaute er ein Stück Fleisch, wickelte es in einen alten Lumpen und schmiß es über die Mauer in unseren kleinen Garten, der gleich dahinter lag. Wir Frauen holten es im Dunkeln heimlich ins Haus. Natürlich lebten wir nicht von Rinderfilets - aber ab und zu steckte schon mal ein Braten in der Röhre. Das durfte ausnahmslos nur nachts über die Bühne gehen. Am Tage das Mietshaus mit Bratenduft zu füllen, wäre lebensgefährlich gewesen und hätte die sofortige Verhaftung meines Vaters wegen Sabotage zur Folge gehabt. Fortuna stand immer auf unserer Seite. Zum Glück wohnte in unserem Haus noch eine Familie, deren Vater auf einem Schlachthof arbeitete. Als aus dessen Wohnung eines Tages verlockende Düfte quollen, blinzelte mein Vater dem Nachbarn listig zu und sie kamen in ein vertrauliches Gespräch. Der liebe Mann gestand leise, daß er in seinem hohlen Holzbein das versteckte, was seine Familie zum Überleben brauche, aus dem Schlachthof rausschmuggele. Wer will es ihm verdenken? Im ersten Weltkrieg hatte man ihm ein Bein weggeschossen und sein Holzbein, welches ihn immer so unglücklich machte, war nun ein Glücksbein. Für uns auch, denn wir hatten einen Neider weniger im Haus.
Das Deputat bestand meistens nur aus Fleisch - oder Suppenknochen - aber was heißt "nur Knochen?" Knochen bedeuteten Leben, kräftige Brühe und wertvolles Fett. Nachdem meine Mutter sie zweimal ausgekocht hatte, kamen regelmäßig Nachbarn und holten sie sich ab wie einen kostbaren Schatz. Sie schlugen sie in kleine Stücke und kochten sie ein drittes und ein viertes Mal.
Das Fett der Brühe schöpfte meine Mutter ab, um Einbrenne oder Brotaufstrich herzustellen. Sehr oft tauschte sie frische Knochen gegen Erbsen, Brot, Mehl, Zucker oder Kartoffeln. Längere Zeit nach dem Russeneinmarsch versorgten uns ehemalige italienische Kriegsgefangene, die mit meinem Vater zusammen gearbeitet hatten, mit Brot. Sie warteten auf eine Transportgelegenheit in die Heimat, was bis zum Hochsommer dauerte. Sie halfen uns, wo es nur ging. Besonders Palo. Palo wußte, was mir geschehen war und hütete mich von nun an, wie seinen Augapfel und wollte irgendwie gutmachen, was seine Verbündeten im Kampf gegen die Deutschen mir angetan hatten. Vielleicht erträumte er sich auch für die Zukunft etwas, was unerfüllt blieb, denn es dauerte Jahre, bis ich nach den Erfahrungen mit der Roten Armee für die Liebe bereit war. Palo wurde ein treuer Freund meiner gesamten Familie und als er im August heimfuhr, weinten wir alle. 15 Jahre später besuchte ich ihn zusammen mit meinem Mann in Battipaglia bei Salerno.
Doch zurück zu meiner Mutter. Wenn sie wußte, es reicht, was sie auf unsere Teller legen konnte, gab sie großzügig ab. So fanden sich, hauptsächlich abends, Freunde und Nachbarn, ganz zufällig, bei uns ein. Jeder lauerte insgeheim darauf, daß sie ihm zuflüsterte: "Bleib hier - du kannst mitessen!" Meistens bildeten wir eine große Runde, die um unseren Ausziehtisch versammelt saß. Unser köstlichstes Essen waren eine Tasse Brühe, Pellkartoffeln mit saurer Einbrennsoße oder Bratkartoffeln mit Sülze vom Fleisch der abgepolkten Knochen.
Eines Tages gab es für uns und für alle die uns nahe standen, ein riesiges Schlemmerfest. Zwei Russen aus der Fabrik, die im organisieren hervorragend waren, hatten sich in unserem Keller ein halbes Schwein versteckt und ließen sich dann nicht mehr blicken. Was nun anfangen mit dem vielen Fleisch? Es war ganz schön warm draußen - im Keller gab es keine Kühlung - aber bald Fliegen. Meine Mutter wechselte immer öfter die feuchten Tücher, mit denen sie das kostbare Fleisch umhüllte. Es wäre eine Sünde gewesen, es verkommen zu lassen. Immer öfter schlich sie mit einem Messer in den Keller. Die beiden Russen hatte man sicherlich abkommandiert. Endlich gab mein Vater die schon etwas verkleinerte Schweinehälfte frei. Stellenweise liefen schon Maden auf ihr herum. Die wurden abgesucht, alles in übermangansauren Kali gebadet - und dann wurde geschlemmt. Es wurde ein Festtag für viele.
Meine Mutter jammerte, weil es keine Seife gab. Daraufhin klaubte mein Vater aus der Kanalisation der Fabrik, die abgelagerten Fettrückstände aus dem Abwasserkanal. Das Zeug war rabenschwarz und stank fürchterlich. Tagelang erfüllten die ekelhaftesten Gerüche unsere Wohnung, denn das alte Fett mußte mehrmals klargekocht werden, bis es zur Seifenherstellung geeignet war. Meine Mutter mixte allerlei geheime Zutaten in den Topf und goß die Flüssigkeit in Formen. Die fertigen Seifenstücke sahen dann nur noch cremefarben aus. Ein fieser Geruch haftete ihnen immer noch an. Sie reinigten zwar, aber ich haßte sie.
In der Zwischenzeit hatten die Russen den größten Teil der Karlshorster Bevölkerung vertrieben, Karlshorst zum Sperrgebiet erklärt und waren selbst in die komplett eingerichteten Wohnungen gezogen. Abdrehen von Wasser, Strom oder Gas, kam für sie nicht in Frage - schließlich waren sie die Sieger. Vielleicht hing unsere Siedlung auch an diesen Zuleitungen, denn ich kann mich an keine Abstellungen erinnern. Es war jedenfalls ein Glücksfall. Karlshorst lag gleich neben uns, gleich hinter dem Bahndamm.
Selbstverständlich durften wir nicht so viel verbrauchen, wie wir wollten. Jeder Haushalt bekam nach der Anzahl der Dazugehörigen ein bestimmtes Kontingent zugeteilt, das nicht überschritten werden durfte. Es wurde sehr streng kontrolliert und wenn jemand sein Kontingent überzog, wurden Gas oder Strom rücksichtslos abgesperrt und es winkten üble Strafen. Er galt dann als Saboteur. Wir kochten mit Gas und natürlich kamen wir nie mit unserer Zuteilung aus - nach nur 14 Tagen, trotz aller Sparsamkeit, war die Monatsration futsch. Da kam meinem Vater eine glorreiche Idee!
Wir verbrauchten einfach so viel wie nötig war. Am Tage, ehe der Kontrolleur den Zähler ablesen kam, hing immer ein Zettel im Treppenhaus, auf dem er sich ankündigte. An diesem Abend holte mein Vater eine große Pumpe aus dem Keller mit der man Autoreifen aufpumpen konnte. Ihren Schlauch schloss er in der Küche an die Gasleitung an und wir pumpten wie verrückt Luft in das Zuleitungsrohr. Das war eine viehische Arbeit und jeder von uns kam an die Reihe und mußte pumpen - ohne Ausnahme. Im Schweiße unseres Angesichts standen wir in der Küche auf der eisernen Kochmaschine, die mit Gas kombiniert war und gaben unser Bestes, bis wir vor Schwäche fast herunterfielen. Man mußte den Pumpenschwengel auf- und niederdrücken. Auf und nieder - auf und nieder. Es war eine Ehrensache, erst kurz vor dem körperlichen Zusammenbruch an den nächsten zu übergeben.
Der sensationelle Erfolg beflügelte uns: Der Gaszähler lief bei jedem Pumpenschlag rückwärts. Der Kontrolleur bemerkte nie die geringste Kleinigkeit. Zum Glück zündete er auch nie eine Flamme an, denn dann wäre er uns sofort auf die Schliche gekommen. Am Anfang strömte nämlich ziemlich lange Zeit nur Luft aus den Düsen des Herdes. Von nun an machten wir diese Prozedur immer am Abend vor der Kontrolle.
Mit dem elektrischen Strom kamen wir natürlich auch nicht aus. Mein raffinierter Vater bohrte unten in den Zähler ein winziges Löchlein, steckte einen dünnen Draht hinein und hielt die Zählerscheibe einfach an. Es war genial und wir konnten verbrauchen ,was wir wollten. Wir durften nur nie vergessen, den Draht herauszuziehen, ehe der Ableser auftauchte. Als die Räuberzeit längst vorüber war und wir uns kaum noch daran erinnerten, daß wir so einen Schwindeldraht benutzt hatten, vielleicht 1951-52, erwischte man uns doch noch. Es wurden generell alle alten Zähler abmontiert und in neue eingetauscht. Uns schwante Unheil. Es dauerte nicht lange und meine Eltern wurden verklagt, weil man bei einer Untersuchung unseres alten Zählers das Löchlein entdeckt hatte. Es gab eine richtige Gerichtsverhandlung und meine geständigen Eltern verdonnerte man zu einer ziemlich hohen Geldstrafe, die sie abzahlen konnten. Wir lebten dann schon jahrelang im Westen, da überwies meine Mutter noch treu und brav die Raten in die DDR, bis die Schuld von 1945 getilgt war.
Ganz so lustig, wie sich das alles heute liest, war es aber damals doch nicht. Immer wenn es bei uns klingelte, stürzten wir an das Fenster des kleinen Zimmers, um vorsichtig durch die Gardine zu schmulen, wer da rein wollte. Öfter waren es Russen aus der Fabrik, die zu meinem Vater wollten. Er mußte ihnen Tag und Nacht zur Verfügung stehen, weil er die Kühlung unter sich hatte. O Gott - war das jedes mal eine Aufregung, wenn wirklich Russen vor der Tür standen. Wir waren alle gebrannte Kinder, was Russen betraf und äußerst mißtrauisch und vorsichtig im Umgang mit ihnen. Kein Russe aus der Fabrik sollte uns drei Schwestern sehen und ehe meine Eltern ihnen die Tür öffneten, versteckten sie uns auf dem Balkon und ließen hinter uns das Verdunklungsrollo herunter. Wir mußten uns hinhocken und ganz leise sein. Heute erscheint das unbegreiflich - damals war es eine wichtige Schutzmaßnahme, über die keiner lachte. Manchmal, wenn die Russen wieder gegangen waren und unsere Eltern uns befreiten, roch unsere ganze Wohnung deutlich nach Vanille. Ein Russe, der öfter kam, hatte eine große Flasche Vanillearoma erbeutet und liebte den Duft so sehr, daß er sich regelmäßig damit die Haare parfümierte.
Schon ab Mitte Mai 1945 gab es viele Veränderungen.
Unser erster russischer Stadtkommandant, Generaloberst Nikolai Bersarin, der mit seiner 5.Stoßarmee am 21.4.1945 als erster das Berliner Stadtgebiet übertreten hatte, stellte den neuen Magistrat von Berlin vor. Unser erster Oberbürgermeister wurde Arthur Werner, ein schon pensionierter Regierungsbeamter, farblos und selbst über die Maßen verwundert, plötzlich Oberbürgermeister zu sein.
Man muß den Russen wirklich ein Lob darüber aussprechen, wie schnell sie das zerstörte riesengroße Berlin wieder zum funktionieren brachten. In dieser Ruinenstadt gewaltigen Ausmaßes lag alles danieder. Außer den vielen lebenden erschöpften Menschen, die in den Trümmern hausten, aber beharrlich weiterleben wollten, war Berlin tot. Es gab nichts - gar nichts.
Alt-Friedrichsfelde besaß früher einmal zwei äußerst beliebte und gut besuchte Lichtspieltheater. Zu meinem tiefsten Bedauern, wurde das Schloßkino in der ehemaligen Wilhelmstraße, ein Opfer der Bombardierung. Es war mein Lieblingskino gewesen. In unzähligen Jugendvorstellungen an den Sonntagnachmittagen, rutschte ich vor Spannung und Aufregung auf den hölzernen Klappstühlen hin und her. In noch guten Zeiten erwarb ich immer an der kleinen Kasse, zusammen mit der Eintrittskarte, einen klebrigen Nappo, der regelmäßig an den Zähnen hängen blieb und mir mal brutal einen Milchzahn heraus riss.
Während der Vorstellung herrschte meistens tumultartiger Radau, denn wir verfolgten die sich abspielende Handlung mit glühender Begeisterung. Der Kinobesitzer nahm den Lärm gelassen hin. Wenn die Luft im Saal mal zu dick wurde, lief er mit einer metallenen Flittspritze rund um das Feld der Stühle und versprühte eine nach Tannennadeln duftende Flüssigkeit, die wir alle sehr gern schnupperten.
Das andere, das zweite Kino, war das Buschkino, das man später in Volkshaus umbenannte. Dort, Alt-Friedrichsfelde 1-3, residierte in den ersten Monaten nach der Kapitulation, die sowjetische Stadtkommandantur.
Am 14.Mai 1945 fand im Busch-Kinosaal eine große Veranstaltung statt. Bersarin hatte die Kulturschaffenden von ganz Berlin, soweit sie aufzutreiben waren, zusammengerufen um sie aufzufordern, ihre Theater, Bühnen und Kinos in kürzester Zeit wieder zu eröffnen.
Zuerst sollten nur Filme in russischer Sprache gezeigt werden. Synchronisierte Filme gab es noch nicht; darum sollte vor der Aufführung ein Sprecher dem Publikum den Inhalt des Filmes erklären. Der Protokollführer, ein Herr Berger, erklärte sich spontan bereit, diese Aufgabe für das Busch-Kino zu übernehmen. Später sollten auch deutsche Spielfilme gezeigt werden dürfen, aber die mußten erst sehr genau auf tendenziöse Inhalte überprüft werden, was längere Zeit dauern würde.
Bersarin gab bei diesem Treffen bekannt, daß ab sofort alle Kulturschaffenden die Lebensmittelkarte Stufe 2 - genau wie die Arbeiter - erhalten sollen. Bestimmte, besonders wichtige Personen konnten auf Antrag beim Bürgermeisteramt, die Stufe 1 bekommen.
Die nächste Zusammenkunft wurde gleich für den 19.5. 12.00 Uhr mittags festgelegt. An diesem Tag sollte jeder berichten, wann sein Theater spielbereit sei.
Außerdem gab der Generaloberst bekannt, daß mit dem damaligen Tagesdatum die erste U-Bahn wieder fahre.
Weiterhin berichtete er, daß er dafür gesorgt habe, daß 10 000 Milchkühe für die Versorgung der Berliner Kinder zur Verfügung stehen.
Herr Busch plante, sein Kino am 20.5. wieder zu eröffnen, aber schon am 19.5., nach der Sitzung, rauschte der Vorhang zur Seite.
Man kann sagen, ab Mitte Mai entwickelte sich alles rasant. Berlin erwachte aus der Agonie, fing an sich hoch zu rappeln. In kurzer Zeit folgten der ersten U-Bahn weitere reparierte Linien. In 30 Kinos liefen russische Spielfilme. Die ersten Bühnen und Theater öffneten ihre Türen dem begeisterten Publikum. Vom Funkhaus in der Masurenallee ging die erste Sendung der neuen Zeit über den Äther. Leider bemerkte ein Großteil der Bevölkerung davon nichts; es gab kaum Rundfunkgeräte in den Haushalten.
Ein Aufruf hatte uns befohlen, sie auf Sammelstellen abzugeben. Wer seinen Apparat glücklich vor den Plünderungen der Roten Armee hatte retten können, wurde ihn nun doch los. Aus Angst gehorsam, befolgten wir den Aufruf; denn Angst hatten wir alle reichlich. Eine erste Zeitung erschien, die "Tägliche Rundschau". Die letzte war kurz vor Kriegsende der "Panzerbär" gewesen, der Aushalteparolen verbreitete
Am 20.Mai fand im Lichtenberger Stadion das erste große Fußballspiel statt. 10 000 aufgeregte Zuschauer fanden sich ein. Die Trümmerfrauen wurden geboren, mehr gegen ihren Willen als aus eigenem Antrieb. Sie wurden einfach dienstverpflichtet, für einen Stundenlohn von, wenn es hoch kam, 79 Reichspfennigen. Nur wegen der besseren Lebensmittelkarte folgten sie dem Aufruf. Hausfrauen, Alte, Kranke und Nichtarbeitende bekamen die kleinste Karte, was zur Folge hatte, daß im kommenden Winter viele Menschen einfach still verhungerten und erfroren.
Die Frisiersalons eröffneten langsam wieder. Um aufgenommen zu werden, mußte man für das heiße Wasser zwei Briketts und zwei Stückchen Holz abgeben, selbstverständlich brachte man eigene Handtücher mit. Voranmeldungen gab es nicht; jedenfalls nicht für uns arme Sterbliche. Der Salon war ständig mit wartenden Frauen überfüllt. (Damen gab es damals sehr wenige). Entweder man wartete stundenlang - oder man ließ es bleiben und ging wieder. Meistens setzte man sich doch in die rappelvolle Bude, denn man legte wieder mehr Wert auf sein Äußeres.
Die Russen begannen in den Industrieanlagen mit der Demontage bis hin zum Kahlschlag der Betriebe.
Unser Haus wurde nun nicht mehr von plündernden Horden der Roten Armee heimgesucht - aber noch öfter, hauptsächlich nachts, klang der Lärm vom riesigen Laubengelände, das hinter unserer Siedlung begann, zu uns herüber. Wenn dort Russen einfielen, veranstalteten die Laubenpieper einen Heidenlärm, indem sie Topfdeckel zusammenschlugen. Wenn eine Familie damit anfing, fielen die anderen mit ein und es gab einen Wahnsinnskrach, der die Russen vertrieb. Die Vergewaltigungen ließen auch nach - aber in Sicherheit wiegen durfte man sich noch lange nicht.
Nachbarn, die wir jahrelang kannten, behaupteten plötzlich von sich, schon immer Kommunisten gewesen zu sein - ja sogar manchmal Opfer des Faschismus. Wir standen sprachlos vor einem Phänomen. Sie blähten sich auf, fingen an sich hervorzuspielen - und bekamen sofort irgendwelche Pöstchen.
Plötzlich gab es Hausobmänner oder Straßenobmänner und die mußten über ihr Gebiet wachen. Sie mischten sich in alles ein und erstatteten Bericht bei neu gegründeten Hilfspolizeirevieren oder auf den russischen Kommandanturen. Sie wollten sich bei den neuen Herren Liebkind machen und traten übereifrig in die von der Roten Armee geförderte KPD ein. Das kam uns recht merkwürdig vor und wir begegneten dieser Entwicklung mit Mißtrauen. Jeder von uns wurde von den neu ernannten Obmännern, von denen plötzlich manche russisch sprechen konnten (wer hätte das vermutet?) genau registriert. Ohne Ausweis durfte man sich nicht mehr aus dem Haus wagen. Überall schwebte man in der Gefahr, auch von russischen Soldaten überprüft zu werden. Wer keine Papiere hatte, wurde mitgenommen und verschwand oft spurlos für immer.
In dem Befehl Nr. 1, den Generaloberst Bersarin schon am 28.April herausgegeben hatte, hieß es, unter sehr vielen anderen Befehlen, daß alle ehemaligen Mitglieder der NSDAP sich zu melden hatten. Ebenso alle ehemaligen Aufseher und Angestellte von Lagern und Gefängnissen, sowie von Polizeistationen der Nationalsozialisten. Seitdem begann in aller Ruhe das Kesseltreiben. Die Hatz war eröffnet!
Straflager schossen wie Pilze aus der Erde. Gefürchtete Stätten wie Hohenschönhausen, Weesow bei Werneuchen und Ketschendorf entstanden. Wegen totaler Überfüllung machte man weitere auf, wie Bautzen, Landsberg an der Warthe und Neu-Brandenburg. Viele andere Elendsquartiere folgten. Plötzlich gab es in allen Bezirken GPU-Gebäude für erste Vernehmungen. Bevorzugt beschlagnahmte man dafür große Häuser mit finsteren Kellern. In unserer Nähe werden die GPU im Prenzlauer Berg, eine andere in der Magdalenenstraße und die in Friedrichsfelde, geradeüber von der evangelischen Kirche, Ecke Schloß- und Wilhelmsstraße, heute Alfred-Kowalke-Straße, und Straße am Tierpark zu gefürchteten Adressen. Nebenbei gab es viele Keller in unscheinbar aussehenden Häusern, in denen brutale Verhöre stattfanden, von denen nur wenige berichten können, weil die meisten erschlagen wurden.
Statt der Elendskolonnen aus dem befreiten Arbeitserziehungslager Wuhlheide im Triftweg, schlurften nun andere abgerissene Gestalten in langen Zügen über die Treskowallee. Es waren Angehörige der ehemaligen deutschen Wehrmacht, die in russische Gefangenschaft geraten waren oder verhaftete Zivilisten, die größtenteils Opfer von Denunziationen geworden waren, die man in die Lager trieb. Wie ein Lauffeuer ging es diesen Transporten voraus: "Es kommen wieder Gefangene!" Entweder liefen nun die Frauen aus unserer Siedlung und aus dem Laubengelände an die Ecke des Triftweges an der Treskowallee, um mit bangen Herzen, die von Russen schwer bewachte, manchmal fast endlose Menschenschlange nach ihren verschwundenen Männern, Brüdern oder Söhnen abzusuchen - Frauen liefen seltener darin mit - oder man flüchtete von der Ecke, als könnte man sich da mit der Pest infizieren. Zur Flucht gab es einen plausiblen Grund: Hatten die russischen Wachtposten bemerkt, daß die Anzahl der Häftlinge nicht mehr stimmte, weil einer ausgerückt, erschossen oder erschlagen war, fingen sie einfach irgendjemanden von der Straße ein, der sich zufällig neben der Kolonne befand. Alles Schreien und Beteuern der Unschuld half dem Ärmsten nichts. Die Russen reihten ihn mit Gewalt ein und so mancher blieb bis heute verschwunden.
So ganz harmlos waren die Russen in der Fabrik, in der mein Vater arbeitete und mit denen er seine kleinen Geschäftchen machte, auch nicht; aber das erfuhr ich erst 55 Jahre später von meinem Buddelkastenfreund Wölfchen. Damals 1945, tauchte mein Vater eines Abends bei seinen Eltern auf und bat sie, nach Friedrichsfelde in die Bäckerei zu gehen, die in dem großen Eckhaus an der U-Bahn Friedrichsfelde, Alfred-Kowalke-Straße, Einbecker Straße ist. Ganz heimlich unter vorgehaltener Hand, sollten sie der Bäckersfrau zuflüstern, daß ihr Mann im Keller der Fleischwarenfabrik gefangen gehalten wird. Wölfchen und sein Vater liefen los und überbrachten die Botschaft. Überglücklich, wenigstens ein Lebenszeichen von ihrem Mann zu erhalten, schenkte die Frau den Überbringern der Nachricht ein ganzes Brot. Wölfchen erinnert sich noch heute daran, was dieses Brot für eine Kostbarkeit war. Andächtig trugen sie es heim.
Die Bäckerei gibt es heute noch, aber sie ist mehrmals in anderen Besitz übergegangen. Nach so vielen Jahre sind die Spuren verweht; aber ich hörte, der Bäcker sei wieder zurückgekehrt zu seiner Frau, denn er habe noch jahrelang seinen Laden weiter betrieben. Es kann sein, daß er Klump hieß. Vielleicht weiß es jemand. Ob in dem Keller der Fabrik noch andere eingesperrt waren? Kein Mensch weiß es zu erzählen.
Überall hing man große Plakate auf. Auf manchen stand in deutscher Schrift, "Dem deutschen Volke wird nichts geschehen", oder "Die Hitler kommen und gehen - aber das deutsche Volk bleibt", Josef Stalin.
Der Befehl Nr. 5, den Bersarin am 31.Mai 1945 herausgab, stürzte unsere ganze Kriegerheimsiedlung in ungeheure Verwirrung und Ratlosigkeit. Ich vermute, so erging es allen Berlinern.
Bis zum 2.Juni mußte jedes Haus die vier Fahnen unserer Siegermächte vorweisen können, in der Größe von 80 mal 180 cm. Kein Mensch wußte ganz genau, wie die fremden Fahnen eigentlich aussahen. Die Hauptschwierigkeit bereitete die amerikanische Flagge. Ja - daß sie Sternchen hatte, wußten wir - aber wie viele und mit wieviel Zacken - davon hatte kein Mensch eine Ahnung. Ein unsagbares Durcheinander unter den sechs Mietparteien unseres Hauses begann. Ein Auf- und Abgerenne von Etage zu Etage, ein Hin und Her von Wohnung zu Wohnung fand statt. Wir glichen einem aufgescheuchten Hühnerstall. Im Treppenhaus gab es dann der Einfachheit halber ein großes Palaver - bis sich endlich alle Beratungen in unserer Küche konzentrierten.
Woher sollten wir die vielen bunten Stoffe nehmen? Wer noch eine alte Nazifahne versteckt hatte, war jetzt fein raus; der brauchte nur das weiße Rund mit dem schwarzen Hakenkreuz herauszutrennen und auf den kahlen Fleck Hammer, Sichel und Stern setzen.
Wir hatten keine mehr im Haus. Als die Front immer näher rückte und das Donnern der Geschütze zu hören war, behauptete meine Mutter, daß die Russen nicht entzückt sein würden, wenn sie bei uns eine nationalsozialistische Fahne finden würden. In der Waschküche, die im Keller lag, entfachte sie unter dem großen Wasserbottich ein kräftiges Feuer und verbrannte alles, was ihrer Meinung nach schädliche Auswirkungen haben könnte, so auch meine BDM-Uniform und meine Liederbücher. Die anderen Mieter unseres Hauses schlossen sich ihr heimlich an. Von dem großen Feuer profitierten auch zwei junge deutsche Soldaten, die sich zu uns geschlichen hatten und um Zivilklamotten baten, weil sie sich verdrücken wollten. Meine Mutter, eine couragierte Frau, ließ sie sich ausziehen und gab ihnen dreckige Öl verschmierte Arbeitsbekleidung meines Vaters und jedem ein Werkzeug in die Hand, damit es aussah, als wären sie Arbeiter. Ob ihr bewußt war, daß in der Stadt schon viele derartige Helfer an Laternenmasten baumelten? Mit einem Pappschild vor der kalten Brust, auf dem zu lesen stand: "Ich habe mein Volk und meinen Führer verraten?"
Also - da wir keine Nazifahne mehr hatten, mußte ein altes Federbett geopfert werden wegen des roten Inletts. Als wahrer Retter in der Not fungierte Herr Walter von ganz oben; den wir, um ihn von anderen Walters zu unterscheiden, nur "der mit dem Spitzbart" titulierten. Er stiftete herrlichen blauen Stoff. Weiß bereitete keine Schwierigkeit; da mußte einfach alte Bettwäsche herhalten. Aber die Sternchen! Die Sternchen machten uns bald wahnsinnig. Alle Frauen des Hauses halfen bei der Näherei. Wer keine Nähmaschine hatte, bastelte und heftete die verflixten Sternchen oder Hammer und Sichel. Natürlich waren wir bereit und auch gewillt, den Befehl Bersarins nachzukommen - an Gehorchen waren wir gewöhnt.
Am 2.Juni, wie befohlen, waren die vier Fahnen für unser Haus fertig. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, aus welchem Grund wir sie dann heraushängen mußten. Nach meinem Wissen geschah es auch nur ein einziges Mal. Wo sie geblieben sind, entzieht sich meiner Kenntnis; aber im Armeemuseum in Karlshorst, kann man einen Satz von diesen Fahnen bestaunen, der überlebt hat.
Wenn irgendwo ein Pferd stürzte und nicht mehr hochkam, liefen die Menschen, schon bevor es die Augen schloß, zusammen und bildeten eine erwartungsvolle Traube. War es dann endlich tot, zerlegte man es sofort an Ort und Stelle. Jeder säbelte sich mitten auf der Straße ein Stück heraus, so gut es ging. Es war eine Mordsschweinerei - eine Orgie in Blut und Fleisch und Gedärm. War es ein Pferd der Roten Armee gewesen, verzichteten die Soldaten meistens zugunsten der Bevölkerung.
Ende Mai 1945 rief man alle Jugendlichen ab 14 Jahre zum Arbeitseinsatz zusammen und das war gut so. Früh um 8.00 Uhr mußten wir uns vor dem damaligen kleinen Kaufhaus Friedrichsfelde versammeln und wurden in Arbeitsgruppen aufgeteilt. Ich landete auf irgendeinem Güterbahnhof und sollte helfen, von Russen ausmontierte Maschinen in Bahnwaggons zu verladen. Das konnte ich nicht, das überstieg meine Kräfte; das war Schwerarbeit für Männer. Unsere Bewacher sahen das selber ein und am nächsten Morgen trafen wir uns mit Schippen und Spaten am Schloßpark Friedrichsfelde. Etwa dort, wo heute der Eingang Bärenschaufenster ist. Geraderüber lag das alte Gartenrestaurant Steiers Waldschloß, das im Krieg als Lager für ausländische Zwangsarbeiter benutzt wurde.
Kurz vor Ende des Krieges hatte sich noch eine Kampfeinheit der Waffen-SS im alten Park eingenistet. Aus diesem Grund gab es in unserer Gegend verhältnismäßig großen Widerstand. Deutsche und Russen beharkten sich ganz mächtig, wovon 4 ausgebrannte Panzer allein in der Nähe unserer Bunker zeugten, in denen wir gesessen hatten und auf unser Ende warteten. Die SS hatte sich in die Hügel des Treskowschen Parks , da wo heute die Bären ihre Anlagen haben, große Breschen gebuddelt, um darin, gut getarnt, ihre Panzer einzustellen. Die mußten wir nun zuschippen und auch die vielen Bomben- und Granattrichter, Unterstände und Laufgräben. Für uns junge Leute erwies sich dieser Arbeitseinsatz als sehr günstig. Auch unsere Eltern konnten beruhigt sein, sie wußten wenigstens einigermaßen, wo wir steckten und was wir taten. Es war nämlich üblich, daß die Rote Armee die Menschen einfach von der Straße einfing, auf einen Laster lud und irgendwohin zum Arbeitseinsatz fuhr. Hauptsächlich zu Aufräumungsarbeiten. Es passierte ihnen nichts. Abends entließ man sie mit einem dicken Kanten Brot und sie mußten zusehen, wie sie wieder nach Hause kamen. Das konnte ungeahnte Schwierigkeiten bereiten, weil Deutsche abends nicht mehr auf die Straße durften. Zuerst galt die Sperrstunde schon ab 20.00 Uhr, später lange Zeit ab 22.00 Uhr.
Noch etwas war wahnsinnig wichtig: Unsere alte Clique fand wieder zusammen. In unserer Kriegerheimsiedlung gab es damals viele gleichaltrige Jugendliche. Meistens kannten wir uns schon aus den Sandkästen. Wir besuchten die gleichen Schulen, die gleichen BDM- und HJ-Gruppen, kannten die häuslichen Verhältnisse jedes Einzelnen und wir fühlten uns alle sehr verbunden. Ich kam endlich wieder mit meinen Freundinnen zusammen, von denen ich auszugsweise nur Margot, Inge, Margrit und Jutta nennen will. Dann waren da noch meine engen Freunde Wölfchen und Günter und viele andere.
Günter Radelhof überragte uns alle ein ganzes Stück. Er hatte schon am 5.April 1945 seinen 16.Geburtstag gefeiert. Wir anderen erreichten dieses heiß ersehnte Alter erst spät im Sommer. 16 Jahre - das war doch schon was! Dann durfte man endlich in die begehrten Kinovorstellungen. Günter konnte mächtig zupacken. Irgendwie wirkte er lustig mit seinen unendlich vielen Sommersprossen auf sehr heller Haut, seinen meistens sehr kurz geschnittenen roten Haaren und der Nickelbrille mit den kreisrunden Fenstern auf der Nase. Für Sonntags hatte er eine bessere Brille. So wie er aussah, so war er auch: Lustig und frech. Mächtig frech konnte er sein. Stets hatte er einen Witz und einen flotten Spruch auf Lager. Ich fürchtete seine Bemerkungen immer etwas. Mit Wölfchen zusammen verbrachte er ein halbes Jahr in Lagern der Kinderlandverschleppung (Kinderlandverschickung) in Litzmannstadt. Ich bin nicht überzeugt, daß Günter dort begeistert mitmachte, denn er kaute an seinen Fingernägeln. Im KLV-Lager verdonnerten ihn die HJ-Führer dazu, stundenlang ein umgehängtes Plakat zu tragen, auf dem stand: "Ich kaue auf meinen Nägeln" oder so ähnlich.
Früher, ehe der Kampf um Berlin begann, trafen wir uns immer an der Ecke Triftweg/ Kriegerheimstraße, heute Splanemannstraße, Ontarioseestraße. Genau da, wo auch heute noch, genau wie damals, eine Telefonzelle stand. Fast immer hatten wir unsere Fahrräder bei uns. Auf die waren wir stolz - die liebten wir sehr. Nun besaß keiner von uns mehr ein Rad. Alle hatten längst die Russen geklaut - genau wie unsere Konfirmationsuhren. Früher gab es die erste Uhr nie vor der Konfirmation. Wenn man Wölfchen jetzt nach seinem Rad fragte, sagte er: "Das ist in Rußland zur Reparatur!" Ach - gerade Wölfchen war immer so stolz auf sein Rad mit den dicken Ballonreifen gewesen.... Im Geiste sehe ich immer noch, wie er mit Günter Radelhof und Arno Ehrenberg nach Karlshorst fuhr. Alle drei auf Wölfchens Rad. Günter der stärkste, strampelte in die Pedale. Auf seinen Schultern saß Arno und vorne auf der Stange Wölfchen, die Beine lässig über den Lenker gebammelt. So fuhren sie immer vergnügt zu den Flakhelfern, die vorher auf der großen Wiese, unserem ehemaligen Indianerland, stationiert waren und mit denen sie sich angefreundet hatten. Einige Zeit vor Kriegsende verlegte man die ganze Batterie hinter die Karlshorster Pionierkaserne, um sie für den Bodenkampf einzusetzen. Auf die große Wiese stellte man schwere 10,5 Geschütze. Wenn die losballerten, bebte unsere ganze Siedlung.
Wir freuten uns also, wieder zusammen zu sein. Wir hatten die Clique so nötig, denn wir waren alle geschundene, gebrannte und enttäuschte junge Hunde. Margots, Magrits und Juttas Väter waren tot, Wölfchens Bruder Helmut, der Mann meiner Schwester und und. Es tat uns gut, zusammen im Park zu buddeln. Es gab wieder Spaß und wir taten einfach, als wäre uns nichts geschehen, als wären wir noch die Kinder von vor dem Russeneinmarsch. Besonders wir Mädchen taten so und eine gewisse Zeit klappte das auch.
An einem Tag, als die Sonne heiß vom Himmel brannte, veranlaßte uns ein penetranter Verwesungsgestank in einen zerschossenen Panzer zu gucken, an dem wir schon öfter rumgespielt hatten. Wir fanden noch einen toten Soldaten. Das, was noch von ihm übrig war, paßte in eine kleine Blechkiste für Munition. Die vielen anderen Gefallenen der Umgebung waren längst eingesammelt und verbuddelt. Überall stieß man auf Holzkreuze aus zusammengebundenen Ästen. Russen und Deutsche genau in zwei Gruppen sortiert. Die Stahlhelme auf den Kreuzen zeigten die Zugehörigkeit an. Margots Vater lag auf der großen Wiese, nicht weit von Thiemanns Bude.
An einem feuchten, kalten nieseligen Tag beobachtete ich, wie russische Soldaten die Bibliothek des Friedrichsfelder Schlosses auf einen offenen Laster warfen und abtransportierten. Mir blutete mein Herz. Mit dem ersten Bilderbuch, das man mir in der Kinderzeit in die Händchen drückte, war in mir die Liebe zu Büchern erwacht. Ich fühlte, daß es gut so war, daß der alte Herr von Treskow, den die Russen von seinem Besitz verjagt hatten, gestorben war. Was müßte er erst gefühlt haben, wenn er hätte sehen müssen, wie man mit seinen kostbaren Büchern umging.
Schon alleine die Tatsache, ein hübsches junges Mädchen mit einer reizvollen Figur zu sein, brachte mich in vielerlei Bedrängnisse von Seiten der russischen Soldaten und in hunderterlei Gefahren. Manche Situationen waren bizarr, geradezu grotesk. Meine Enkeltochter wird erstaunt sein, wenn ich ihr erzähle, was mir so alles passiert ist, in dieser wirren Zeit. Damals konnte ich darüber nicht lachen, das war mir vergangen.
Wieder an einem Tag, wir buddelten gerade nicht weit vom Zaun an der Treskowallee, heute heißt sie "Am Tierpark", kam eine offene Kutsche angefahren, in der ein russischer Offizier mit vielen Orden an der Jacke saß. Sein junger Kutscher bog in den Park ein und kam zu uns kutschiert. Der Offizier mittleren Alters stieg aus und beobachtete uns eine ganze Weile - und urplötzlich gab es mächtigen Strabbel. Ausgerechnet ich sollte mit ihm mitfahren. Ich dachte, mich laust der Affe, ich hatte geglaubt, diese Zeit sei endlich vorbei. Ich kriegte eine Wahnsinnsangst, denn was mir blühen sollte, ahnte ich. Alles ging gut für mich aus. Einer unserer Bewacher, wir wurden immer beaufsichtigt, erwies sich als der Beschützer. Er trat sehr energisch auf und sagte, er sei für uns verantwortlich, wir ständen unter seinem Schutz und von uns würde keiner, ob Mädchen oder Junge, so einfach weggeholt. Nach einem endlosen hin und her, gab der Offizier nach, setzte sich wieder in seine Kutsche und ließ sich aus dem Park fahren. Mir fiel ein Stein vom Herzen - aber 14 Tage später gab es ein Nachspiel.
Wie ich schon schrieb, brachten die Russen in bewundernswerter Schnelligkeit das Leben in der zerstörten und verstörten Stadt in Fluss. Es kann kaum Mitte Juni gewesen sein, als Plakate ankündigten, daß in unserem, damals wirklich sehr schönen Kapitol-Kino am Bahnhof Karlshorst, die erste Varité-Vorstellung nach dem Krieg stattfinden sollte. Unsere Clique hielt es für eine Ehrensache, dabei zu sein. Berühmte und beliebte große Künstler traten damals in ganz kleinen Sketchen in Kinos oder Sälen auf, nur um die bessere Lebensmittelkarte zu bekommen - was ohne weiteres ein guter Grund war.
Dieser Tag erschien uns wie ein Festtag. Natürlich pilgerten wir alle hin. Alles kam uns wie ein Wunder vor. Die Welt war auf einmal so leicht und lustig. Wir amüsierten uns köstlich und klatschten den Künstlern enthusiastisch unseren Beifall zu. Plötzlich ging das Licht an und man unterbrach die Vorstellung. Unruhe breitete sich aus. Eine Gruppe russischer Offiziere kam von hinten in den Zuschauerraum und den Gang entlang. Der Offizier, der vorneweg ging, suchte mit den Augen jede Sitzreihe der Länge nach ab. Als er mich entdeckte, blieb er stehen, strahlte mich an und winkte, ich solle aus der Reihe heraus zu ihm kommen. Ich erstarrte und erkannte ihn. Es war der Russe aus der Kutsche im Schloßpark. Ich weigerte mich und ging nicht zu ihm, ich sah einfach in eine andere Richtung. Da wurde er lauter und energischer. Ich sah einfach nicht zu ihm hin. Ein Tumult entstand und mich überkam richtige Unwirklichkeit. Mit einem Mal hörte ich neben mir eine laute Stimme. Was für ein Glück - Palo war da. Palo bekam fast einen Tobsuchtsanfall. Rasend vor Wut schrie er in Russisch, Deutsch und Italienisch auf den Offizier ein. Das tobte so eine Weile hin und her, dann zog sich die Gruppe Russen zurück. Mit so kräftigem Widerstand hatten sie wohl nicht gerechnet. Das Licht ging wieder aus - die Vorstellung weiter.
Alle Jungen schwärmten damals für Schaftstiefel. Jeder wollte ein Paar besitzen und so wurden Wölfchen und Günter heiß beneidet, denn beide besaßen richtige schicke schöne Stiefel - und trugen sie auch.
An einem wüsten Tag, wie alle anderen, trat Wölfchen gerade aus seiner Haustür, da stürzte auch schon einer aus der Clique auf ihn zu und rief: "Mensch jeh bloß wieder ruff und zieh die Stiefel aus - gerade klauen die Russen an der Ecke dem Günter seine!" Na - Wölfchen - nichts als hoch in die Wohnung um die Dinger auszuziehen, in andere zu schlüpfen und runter an die Telefonzellenecke zu rennen.
Da hatte sich folgendes abgespielt: Günter stand ganz ahnungslos in seinen Stiefeln und quatschte mit Freunden, als sich drei Rotarmisten näherten: ein etwas Ranghöherer und zwei einfache Untergebene. Der Höhere entdeckte sofort Günters strahlend blank geputzte Stiefel und befahl ihm kurz und streng, sie auf der Stelle auszuziehen. Dem armen Günter blieb nichts weiter übrig, als sie von den Füßen zu ziehen. Die Russen hatten die Macht und übten sie auch aus. So war das eben. Der mit dem höheren Dienstgrad, zog seine auch aus, winkelte die Fußlappen fester und zog Günters Stiefel an. Seine gab er an den zweiten, einfacheren Soldaten weiter, der sie auch sofort anzog und seine eigenen an den dritten Russen gab. Die Stiefel, die dem letzten, dem dritten Russen gehört hatten, waren nur noch alte zerfledderte, fleckige abgelatschte Filz- und Leinengaloschen. Die gab er weiter an Günter. Vier Paar Stiefel hatten die Runde gemacht - jeder besaß ein neues. Zufrieden zogen die Russen weiter. Unglücklich stand Günter in über und über gestopften Strümpfen an der Ecke und starrte auf die mistigen Botten. Die konnte er unmöglich anziehen. Mit Wölfchen zusammen beerdigte er die eindrucksvollen Bekleidungsstücke der Roten Armee in einem noch nicht zu gebuddelten Einmannloch vor dem Fenster der dicken Müllern. Vielleicht könnte man noch Reste finden, wenn man nachgräbt. Filz hält sehr lange.
Die Rote Armee baute über die großen Zufahrtsstraßen mächtige Siegestore, die aber eher Attrappen waren und meistens nur aus Holz bestanden, das man mit einer blutroten Farbe anmalte. War blutiges Rot bezeichnend für diese Zeit?
Rundherum häuften sich die Verhaftungen durch Denunziationen. Wie es in allen Diktaturen üblich ist, fing jeder an, jedem zu mißtrauen. Gute altbekannte Nachbarn wurden zu Feinden. Warum taten die Verräter das, so oft grundlos? Für was? Um von sich selbst abzulenken? Um den neuen Herren zu dienen, um sich wichtig zu machen, um die eigene Haut zu retten, für ein Stück Brot - ein Stück Speck - lieber der als ich?
Die Zeit ließ auch in mir eine miese Ader wachsen. Tagelang konnte ich an nichts anderes denken als an Grießbrei. Wenn es uns auch besser ging, als den anderen rundherum, blieben doch viele Lüsterchen unbefriedigt. Ich wußte, daß auf unserem Schrank im Schlafzimmer ein kleines Säckchen mit Grieß lag. Es konnten so ungefähr 5-6 Pfd. gewesen sein. Ich wußte es genau, ich hatte das Säckchen im Rucksack selbst von Forst zu uns nach Berlin transportiert. Die Rückfahrt hatte drei Tage gedauert. Forst war schon Frontstadt, die Zivilbevölkerung bis auf wenige Ausnahmen längst geflüchtet, und drüben am anderen Neißeufer lagen die Russen. Meine Schwester Evchen, die bei meiner Großmutter in Forst aufgewachsen war und ich, schmuggelten uns noch mehrmals in die Stadt, in unser verwaistes Haus, um noch Wäsche und Lebensmittel herauszuholen. Dieser Grieß ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich konnte nur noch an Grieß denken, und wie er schmecken würde, wenn ich ihn mit Wasser und Süßstoff zu einem Brei verkochen würde. Nur ein winziges Töpfchen voll... Ich wußte genau, der Grieß gehörte den kleinen Kindern unserer Familie.
Eines Tages hielt ich es nicht mehr aus. Ich stieg auf einen Stuhl und nahm zwei Esslöffel Grieß aus dem Säckchen heraus, spazierte in die Küche und kochte mir frech und vor aller Augen eine dicke herrliche Suppe. Meine Schwestern und meine Mutter erstarrten vor Überraschung zu Salzsäulen und dann gab es ein Donnerwetter - was mir einfiele so gierig zu sein und den Kindern den Grieß wegzunehmen. Rotzfrech redete ich mich raus, ich sehe da kein Problem, denn sie essen doch auch alles mit, was Papa organisiere. Warum soll ich da nicht auch mal eine kleine Grießsuppe essen? Meine Mutter und meine Schwestern schwiegen sprachlos über so viel Boshaftigkeit. Keiner sagte mehr ein Wort und sie ließen mich die Suppe essen - aber ich schämte mich plötzlich fast zu Tode. Noch heute sitzt mir ein Löffelchen davon in der Kehle.
Der erste Stadtkommandant von Groß-Berlin, Generaloberst Nikolai E. Bersarin, war ein leidenschaftlicher Motorradfan. Er liebte es, im Morgengrauen auf seiner schweren Maschine, einer Harley-Davidson, in einem Monteuranzug gekleidet, durch sein Reich zu brausen. Er war 41 Jahre alt und stand auf dem absoluten Höhepunkt seiner militärischen Laufbahn. Als Feind war er gekommen, aber nun schätzten und bewunderten ihn die Berliner. Wegen seines Einsatzes für die Interessen ihrer Stadt, erfreute er sich großer Beliebtheit und man brachte ihm Achtung entgegen. Er war von mittelgroßer, stämmiger Figur mit breiten Schultern. In seinem gebräunten runden Gesicht saßen kluge lebhafte Augen. Am liebsten trug er seine alte Lederjacke - im Mundwinkel steckte meist die unvermeidliche Zigarette.
Am 16.Juni 1945 gegen 5 Uhr in der Frühe, donnerte er in hohem Tempo auf der Kreuzung Am Tierpark/Alfred-Kowalke-Straße in Friedrichsfelde, damals Schloßstraße/Ecke Wilhelmstraße, da wo die 69 in die Kurve quietschte, auf eine stehende Fahrzeugkolonne der Roten Armee. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
War es überhaupt ein Unfall ? Man munkelte so allerlei. Bersarin hatte viele Neider - auch unter den höchsten russischen Offizieren.
Russen und Berliner waren gleichermaßen bestürzt; aber gerade sein Tod hielt ihn lebendig. Lebendiger als alle seine blassen Nachfolger. Er war der Verdienteste unter ihnen - trotz seiner nur 54tägigen Amtszeit als Stadtkommandant. Ihm hatte Berlin viel zu verdanken; auch, daß die Übergriffe der russischen Soldaten verhältnismäßig schnell endeten.
Nikolai Bersarin wurde am 1.April 1904 in Petersburg als Sohn einer Arbeiterfamilie geboren. Schon mit 10 Jahren endete seine Kindheit und er trat als Buchbinderlehrling in das Berufsleben ein. Mit 14 Jahren trat er freiwillig in den Dienst der Roten Armee. Durch Eignung, Talent, großem Fleiß und unermüdliche Weiterbildung brachte er es vom untersten Soldaten zum hohen Truppenführer. Im Mai 1944, gerade von einer schweren Verwundung auskuriert, ernannte man ihn zum Kommandierenden General einer großen Armee. Als Führer seiner 5.Stoß- und Gardearmee, gelang es ihm am 21.April 1945 mit seinen Soldaten, die Stadtgrenze von Berlin als erster siegreich zu überschreiten. Drei Armeen hatten im Wettstreit gelegen, jede wollte als erste die feindliche Hauptstadt erreichen.
Alter russischer Tradition folgend, wurde Bersarin aus diesem Grund Stadtkommandant von Groß-Berlin. Erst im Juli 1945 spaltete sich die Verwaltung in die vier Bezirke der Alliierten. Von dem Tage an gab es vier Sektoren.
Der Kriegsberichterstatter Lew Scheynin von der Zeitung "Iswestja", der ihn in den letzten Kampftagen an der Front begleitet hatte, schrieb über ihn, er sei ein kluger und großherziger Mann. Als Bersarin zum Stadtkommandanten ernannt wurde, war er sehr aufgeregt und konnte es kaum fassen, welche Rolle man ihm auferlegte. Nach 12 Jahren Faschismus hatte er die Deutschen immer nur als Feinde gesehen. Nun auf einmal sollte er ihnen helfen, die neue Stadt Berlin aufzubauen. Wörtlich sagte er: "Verstehst du das, Lew?"
Dann stürzte er sich mit leidenschaftlichem Einsatz in die neue Aufgabe. Viel Zeit blieb ihm leider nicht, um alles zu verwirklichen, was er sich vorgenommen hatte. Zu seinem Nachfolger ernannte man den Generaloberst Alexander Gorbatow.
Doch nun zurück zum eigenen Alltag im Triftweg.
Die Jungen aus unserer Clique hatten weitaus mehr Möglichkeiten sich überall herumzutreiben als wir Mädchen. Ihr Eldorado wurde wieder die große Wiese. Die deutsche Wehrmacht hatte zwar die 10,5 Geschütze unbrauchbar gemacht, indem sie die Schlösser zerstörte, aber die Munition lag in riesigen Haufen überall herum. Wenn Wölfchen und Günter erzählten, was sie damit für Unsinn trieben - und sogar überlebten, sträubten sich einem die Haare.
Ich glaube, es muß Anfang Juni gewesen sein, da kam eine Verfügung heraus, daß alle Personen ab 15 Jahre bis zum 50.Lebensjahr einer geregelten Arbeit nachgehen müssen, sonst bekämen sie keine Lebensmittelkarten. Unser Schippverein hatte sich aufgelöst und unsere Schulen eröffneten erst wieder im Herbst - also hieß es: Auf die Arbeitsuche gehen!
Meine Mutter fand für mich eine Stelle als zahnärztliche Helferin bei einer Frau Dr. Speer. Sie richtete in einem kleinen Haus in der Volkradstraße ihre Praxis ein, genau wie ihr Mann seine Praxis für Allgemeinmedizin.
Ich pendelte zwischen beiden Praxen, half mal hier und mal dort. Es machte mir Freude - denn die Arbeit lag mir gut.
Wir waren sehr überrascht, als eines Tages ein großer, gepflegt aussehender junger Russe in Uniform zu uns in die Sprechstunde kam und eine Behandlung verlangte. Das war nicht üblich - aber er bestand darauf. Kein Wunder - er hatte einen total vereiterten Backenzahn, der höllisch schmerzen mußte. Die Spritze half nicht hundertprozentig und so stellte ich mich hinter ihn und wandte zusätzlich etwas Akupressur an, wie es mich Fr. Dr. Speer gelehrt hatte, um ihm noch eine kleine Erleichterung zu verschaffen. Es wurde eine schwierige Prozedur, den Zahn zu ziehen und unser gequälter Patient stöhnte und sah mich immer ganz verzweifelt an; aber er überstand es, steckte glücklich den Übeltäter in die Tasche und bedankte sich überschwenglich. Wir ahnten nicht, daß wir beide uns unter ganz anderen Umständen wiedersehen sollten.
Ende Juli - Anfang August, führte die russische Armee eine großangelegte flächendeckende Kontrolle unserer Siedlung und der Umgebung durch. Im Morgengrauen holten sie uns aus den Betten, indem sie an die Türen schlugen, als wollten sie sie einhauen. Verschreckt öffneten wir und standen ratlos in unseren Nachthemden herum. Vier schwerbewaffnete Rotarmisten und ein Dolmetscher drangen in unsere Wohnung ein und forderten barsch unsere Ausweise und Arbeitsbescheinigungen. Alle Papiere meiner Eltern und meiner Schwestern erwiesen sich als in Ordnung - nur meine nicht! Ich hatte keine Arbeitsbescheinigung - die lag zur Eintragung bei Dr.Speer. Aus den Gesprächen der Russen untereinander glaubte ich, das Wort Registrierung zu hören. Wer dazu mit mußte, ahnte Schlimmes! In die Augen meiner Eltern trat Panik. Selbst die Russen waren plötzlich still und betrachteten mich nachdenklich und verdutzt.
Ich erklärte dem Dolmetscher, warum ich die Arbeitsbescheinigung nicht hatte, aber er sagte nur, ich solle mich anziehen, ehe er den Russen alles übersetzte. In meinen Knien saß auf einmal so ein wackliges Gefühl und urplötzlich wurde mir ganz mulmig. Die Russen schienen uneinig zu sein, es gab ein riesengroßes Palaver. Einer beharrte laut und verbissen auf seinem Standpunkt. Ich sah ihn mir notgedrungen genauer an und stellte zu meiner Verwunderung fest, daß es der junge Russe war, dem wir vor zwei Tagen den Backenzahn gezogen hatten. Er lächelte mir zu, legte mir beruhigend die Hand auf die Schulter und sagte: "Ich wissen - du gutt Rabotta!" Ich war gerettet. Der Dolmetscher erklärte, sein Kamerad verbürge sich für mich, er habe mich erkannt und meine Aussagen bestätigt. Ich sollte mir aber sofort morgen meine Papiere vervollständigen und nie ohne sie das Haus verlassen - und dann polterten sie wieder raus aus unserer Wohnung - ohne mich.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am nächsten Morgen die Nachricht, daß drei Jungen aus unserer Clique mitgenommen und verschwunden waren: Günter Radelhof, Hans-Joachim Hartpfeil und Arno Ehrenberg.
In der vergangenen Nacht war ein ganzer Trupp zusammengestellt worden, der unter starker Bewachung nach Friedrichsfelde in das Haus der GPU gebracht wurde. Darunter auch aus dem Nebenhaus Herr Wachter mit seiner Wirtschafterin Frau Wiese und dann sogar Margot. Bei den dreien hatten die Papiere nicht gestimmt, sie wurden gründlich erfaßt, ausgefragt, für in Ordnung erklärt - und wieder entlassen. Nur die drei Jungen nicht. Sie waren verschwunden.
Günter war mit 16 der Älteste, die anderen erst 15. Was sollten die schon groß angestellt haben. Wir kannten sie doch genau, waren immer mit ihnen zusammen gewesen. Es konnte unmöglich einen Alleingang der drei gegeben haben. Was sollten sie verbrochen haben? Unsere Clique rätselte hin und her, aber es fiel uns nichts ein. Neuerdings tauchte mehrmals der Name Werwolf auf. Wir hatten nie etwas vom Werwolf gehört. Angeblich sollte das eine besonders scharfe Organisation der Hitlerjugend gewesen sein, die sich ziemlich erst am Ende des Krieges gegründet hatte und auf besonders hinterhältige Anschläge getrimmt war. Von uns wußte keiner etwas vom Werwolf. Ja - bei HJ und BDM hatten wir alle mitgemacht - und nicht mal ungern - aber Werwolf? Den kannten wir nicht.
Traf einer aus unserer Clique einen anderen, drehte sich jedes Gespräch um die drei Verschwundenen.
Wenige Tage später, traf ich früh auf meiner Arbeitsstelle, eine verstörte Frau Dr.Speer an. Vollkommen überraschend waren sowjetische Soldaten gekommen und hatten ihren Mann abgeholt. Keiner konnte ausfindig machen, wo er geblieben war. Frau Dr.Speer gab auf. Ich bekam die Kündigung.
Dann schlug die Stunde von Herrn Wachter aus dem Nebenhaus. Wie üblich im Morgengrauen mußte er auf einen Lastwagen klettern, was gar nicht so einfach war, denn aus dem 1.Weltkrieg hatte er ein Holzbein mitgebracht. Klein, dunkel, mit großer Schnauze und Adlernase, blieb er überzeugter Nationalsozialist und machte aus seiner Gesinnung kein Geheimnis. Er blieb einfach ein Nazi - ganz offen. In der NSDAP war er wohl gar nicht, war aber ein treuer Anhänger seines Führers. Freunde besaß er nicht, er fühlte sich wohl als Einzelgänger. Früher hatte er einmal eine richtige Familie gehabt und sein kleiner Sohn Dieter war mein lieber Spielgefährte geworden - bis wir beide an Diphtherie erkrankten und Dieter daran starb. Die Eltern trennten sich und Herr Wachter verbitterte und vergnatzte. Aber ihn und mich verband eine sonderbare Freundschaft. Ich mochte ihn und er mochte mich. Dieter hatte ein Band zwischen uns geknüpft. Es gab so viele falsche Hunde - er war keiner. Sehr oft stellte er sich abends bei uns zu einer Pellkartoffel mit saurer Einbrennsoße ein. Essig gab es seltsamerweise immer.
Plötzlich hielt sich hartnäckig das Gerücht: Den Wachter hat man auf dem Hof der GPU in Friedrichsfelde totgeschlagen - der und der hat es gesehen! Wir glaubten das zuerst nicht. Einfach totgeschlagen? In uns sträubte sich etwas, das Gehörte zu glauben. Nicht lange danach holten russische Soldaten seine Habe aus der Wohnung. Auch eine kleine Staffelei, die er sich von mir ausgeliehen hatte und die mir die kriegsgefangenen Franzosen in der Fabrik mal zur Freude gebaut hatten. Er und ich, wir malten beide gerne. Ich besitze noch Bilder von ihm. Er kam nie zurück. Man hat ihn wohl wirklich erschlagen.
Nach 8 Wochen tauchten Hans-Joachim Hartpfeil und Arno Ehrenberg wieder auf. Blaß und still. Man bekam kein Wort darüber aus ihnen heraus, was geschehen war. Sie schwiegen verbissen. Sie schwiegen aus Angst, weil man ihnen verboten hatte, zu erzählen, was sie gesehen und erlebt hatten.
Überall fing das große Schweigen an, sich auszubreiten. Man traute nun keinem mehr. Die zaghaften Träume auf eine bessere Zeit, zerplatzten wie Seifenblasen. Fassungslos erlebten wir, wie rundherum, scheinbar wahllose Verhaftungen vorgenommen wurden. Die Angehörigen erfuhren nie das Geringste, wohin man ihre Lieben verschleppt hatte. Vergebens belagerten sie die Kommandanturen, um Auskünfte zu erhalten. Kam einer wirklich zurück, schwieg er. Man sah ein, daß die, die sich schuldig gemacht hatten, ihr gerechtes Urteil und eine empfindliche Strafe bekommen mußten - und davon gab es genug. Rache ist eine Ureigenschaft der Menschheit. Aber damit begnügte sich die Rote Armee nicht. Total harmlose Menschen, Jugendliche, manchmal fast noch Kinder, wurden verschleppt.
Hinter vorgehaltener Hand munkelte man von wiedereröffneten Konzentrationslagern. Der Name Sachsenhausen fiel. Wenn man Günters Eltern traf oder seine Schwester, getraute man sich kaum, nach Günter zu fragen. Das Schweigen lag auf ihnen wie eine Schande - so als hätte Günter etwas verbrochen. Viele waren der Meinung, die Russen werden schon wissen, was die Abgeholten ausgefressen haben.
Unsere Clique fiel auseinander. Wir hatten uns durch die Erlebnisse und Erfahrungen verändert. Wir waren keine Kinder mehr. Aus dem Paradies der Kindheit hatte man uns mit Gewalt vertrieben. Wir blieben zwar alle befreundet, aber an der Telefonzelle an der Ecke trafen wir uns nicht mehr. Wenn sich zwei begegneten, fragte immer einer: "Weißt du was von Günter?" - und der zweite schüttelte den Kopf. Keiner wußte was von Günter.
Günter kam nie wieder. Er ist elendich zugrunde gegangen. Heute, 1997, brauche ich nicht mehr zu fragen - ich habe es endlich erfahren.
Erst nach der Wiedervereinigung traute man sich endlich, den Mund aufzumachen und über das Unrecht zu sprechen, das 1945 geschehen war. In der DDR blieb diese Zeit ein Tabuthema, auf das nicht eingegangen wurde.
Mir gelangte 1996 eine kleine Zeitschrift "Der Stacheldraht" in die Hände, die der Bund für stalinistisch Verfolgte herausgibt (BSV). Dort rief ich an, um mich zu erkundigen, ob es möglich ist, jetzt noch, nach so vielen Jahren, etwas über einen Günter Radelhof zu erfahren. Nach nur 10 Minuten erfuhr ich, das Günter am 16.August 1948 in Sachsenhausen verstorben ist.
Ich lernte eine großartige kleine Frau kennen, die selbst Günters schweren Weg gegangen ist und zum Glück überlebte. Fünf elende Jahre hat sie hinter Stacheldraht der Roten Armee zugebracht, saß angstzitternd in den Kellern der GPU Prenzlauer Berg, Berlin-Hohenschönhausen, Weesow und Sachsenhausen. Sie erzählte mir vieles von dem, was man ihr angetan hatte. Man schlug und trat sie, ließ sie fast verhungern und verurteilte sie sogar zum Tode. Nach Tagen der Qual, in der Erwartung auf die Vollstreckung des Urteils, teilte man ihr höhnisch mit, es sei nur ein Scheinurteil gewesen. Sie sagte zu mir: "Man hat mich wie ein Schwein behandelt - aber man konnte kein Schwein aus mir machen, verraten habe ich keinen!"
Durch sie konnte ich mir Günters Leidensweg vorstellen. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist er aus den Kellern der GPU in Friedrichsfelde auch nach Berlin-Hohenschönhausen transportiert worden. Dort, in dem Gebäudekomplex einer ehemaligen Großküche der NSV, verbrachten die Häftlinge die schreckliche Zeit in engen dunklen Kellern. Weil die nicht ausreichten für den Strom der Inhaftierten, die sich ansammelten, mußten sie selbst neue Kellerverließe bauen, die sie dann U-Boot nannten, weil es weder Fenster, Heizung, Waschräume noch Toiletten gab. Man schätzt, daß 3500 Häftlinge in Hohenschönhausen umgekommen sind. Die meisten wurden angeklagt wegen Spionage, wegen Verbreitung von faschistischem Gedankengut, oder dem beliebten Anklagepunkt; der Zugehörigkeit zum Werwolf, der nach Art hinterhältiger Partisanen im Einsatz besonders fanatisch gewesen sein soll. Eine Gerichtsverhandlung gab es fast nie.
Oder Günter saß einige Zeit in Weesow bei Werneuchen. Weesow bestand aus etlichen eingezäunten Bauernhäusern. Wenn man das so liest, hört sich das recht harmlos an, aber es war eine Hölle. Grausamer Hunger, Ruhr, Typhus und Tuberkulose dezimierten laufend die Zahl der Häftlinge. Man füllte sofort auf, denn Häftlinge gab es reichlich. Von Weesow aus schickte man einen Trupp nach Sachsenhausen, um den Komplex herzurichten, damit er erneut in Betrieb genommen werden konnte. Sachsenhausen bei Oranienburg, nicht weit von Berlin entfernt, hatte schon bei den Nationalsozialisten eine große unrühmliche Rolle gespielt. Es war Konzentrationslager und Hauptzentrale für alle anderen KZ gewesen. Hunderttausende starben allein in diesem Lager. Millionen wurden von dort aus in anderen Lagern in den Tod geschickt. Vielleicht mußte die nahe Stadt Oranienburg deshalb unter besonders starker Bombardierung leiden. Noch heute liegen ausnahmsweise viele Blindgänger im Erdreich und gefährden die Bevölkerung. Anfang August nahm man diesen Ort des Schreckens unter der Roten Armee neuerlich in Betrieb. Er wurde für die Internierten des Stalinismus nicht weniger leidvoll als unter Hitlers Schergen. Natürlich saßen dort nicht ausschließlich Unschuldige in Gefangenschaft, sondern auch Nazigrößen, ehemalige KZ-Aufseher und Gefängniswärter, aber eben viel zu viele Unschuldige.
Sachsenhausen hieß nun nicht mehr Konzentrationslager, sondern Speziallager Nr. 7. Insgesamt gab es sieben Speziallager allein im Land Brandenburg. Durch die Eröffnung des großen Nr. 7 konnte man etliche kleinere Lager schließen und die Häftlinge in Sachsenhausen zusammenfassen. Wahllos füllte man es mit Schuldigen und Unschuldigen. Man nahm, wen man fangen konnte - unter den fadenscheinigsten Gründen. Auch Günter Radelhof.
Jetzt erschoß man die Häftlinge nicht mehr, wie in der Nazi-Zeit, oder vergaste sie, jetzt machte man es leiser. Man ließ sie einfach verhungern, erfrieren oder an Krankheiten verrecken. Der Hunger forderte die meisten Opfer. Diese Art von Tod kommt auf leisen Sohlen; ohne laute Auflehnung dämmerte der Häftling schwach und still hinüber. Die Rote Armee nahm das Sterben gelassen hin. Rußland war schon immer hart, was Gefangene betrifft - auch gegen die eigenen. Das Sterben war unwichtig, man füllte die Lager immer wieder auf. Auch das Speziallager Nr. 7.
Die Bevölkerung hörte eigentlich zum ersten Mal etwas von dem wieder neueröffneten Sachsenhausen nach dem 25.9.1946. Solange gab es nur ein vages Gerücht. Aber an diesem Tag starb dort der beliebte Schauspieler Heinrich George an den Folgen einer Blinddarmoperation. Diese Nachricht verbreitete sich schnell und machte aufmerksam.
Außer den Arbeiten, die zur eigenen Versorgung des Lagers nötig waren, durften die Internierten keiner Arbeit nachgehen. Nicht einmal einen Bleistift oder ein Stück Papier durften sie besitzen. Sie duften nicht singen und keine Spiele spielen. Kurioserweise war Schach erlaubt - aber es gab kein einziges Schachspiel. Am allerschlimmsten war das Schweigen zu ertragen, das auf dem Lager lastete. Jahrelang unterband man strikt jede Verbindung zu den Angehörigen. Kein Jugendlicher durfte seine Eltern benachrichtigen. Jedes Speziallager war ein Schweigelager. Die Häftlinge schliefen bis 1947 auf den rohen kahlen Brettern der Holzpritschen, drei übereinander. Sie hatten auch in den kalten Wintern nur eine dünne Decke zum zudecken. Als Kleidung besaß jeder nur das, was er bei seiner Verhaftung auf dem Leib getragen hatte. Das waren oft Sommersachen. Sie konnten sich nur zusätzlich schützen, wenn ein Kamerad von ihnen starb und es ihnen gelang, eine Jacke, ein Hemd oder ein paar Schuhe von ihm zu ergattern. Es gab weder Handtücher, Klopapier noch Zellstoff für die Frauen. Die Durchschnittsbelegung des Lagers lag bei 11000-16000 Personen. Davon hielt man in Sonderbaracken bis zu 1300 Frauen fest. Von den 180000 insgesamt Verhafteten erreichten sowieso nur 160000 die Lager. Die fehlenden 20000 kamen schon vorher in den Kellern der GPU ums Leben. Man ließ auch sie verhungern oder sie starben an den Folgen der schweren Mißhandlungen. Allein Nr. 7 kostete über 30000 Häftlingen das Leben.
Am 10.März 1950, nachdem es schon vorher unter Pieck und Grotewohl endlich gewisse Erleichterungen gegeben hatte, gab man Sachsenhausen auf. Einen Teil der Häftlinge entließ man, andere überführte man in Gefängnisse. Sehr viele transportierte man nach Sibirien. Deren Anzahl blieb bis heute unbekannt - genau wie die Anzahl der in Sibirien Verstorbenen. Sie gelten ganz einfach als vermißt.
Wenn mich heute jemand fragen würde: "Weißt du was von Günter?", dann kann ich sagen: "Ja, ich weiß etwas!"
Ich weiß mehr, als Günters Eltern je wußten. Sie haben von ihrem Sohn nie wieder ein einziges Wort gehört. Günter wurde schon totgeschwiegen als er noch lebte. Seine Gebeine liegen neben denen vieler Leidensgefährten in einem Massengrab auf dem Kommandantenhof verscharrt.
Weder die Rote Armee noch die DDR gaben jemals Auskunft über die Verschwundenen. Es gab keine Behörde, keine Organisation die den verzweifelten Suchenden half und sie aufklärte über das Schicksal ihrer Lieben. Nie und nirgendwo wurde über die Opfer berichtet; nur heimlich hinter vorgehaltener Hand. Bis zu ihrem eigenen Tod erfuhren Günters Eltern nicht, daß ihr Sohn ihnen schon vor vielen Jahren vorausgegangen war. Auf dem Friedhof in Karlshorst, hatten sie auf dem Grabstein ihrer Familie, hinter seinen Namen und sein Geburtsdatum eingravieren lassen
"Verschollen."
Erst durch den Zusammenbruch der DDR und der Sowjetunion wurden die Akten zugänglich. Eine laute Empörung hat es von keiner Seite gegeben. Sind die ehemaligen Speziallager immer noch in gewissem Sinne Schweigelager?
Nachsatz
Unerwartete Ereignisse zwingen mich, einen Nachsatz zu schreiben. Dabei dachte ich, die Günter-Geschichte sei abgeschlossen. Es ist kaum zu glauben, aber nach über 52 Jahren hörte ich wieder etwas über Günter.
Das kam so: Der BSV setzte freundlicherweise eine Suchanzeige für mich auf und veröffentlichte sie im »Stacheldraht«. Dieses kleine Blatt erreicht viele ehemalige Internierte und Gefangene, die unter der Roten Armee gelitten haben. Die Anzeige enthielt ein Bild von Günter und lautete: »Wer erinnert sich an Günter Radelhof? geb. am 5. April 1929, aufgewachsen in Berlin-Friedrichsfelde, mit 16 Jahren im Sommer 1945 wegen Wehrwolfverdachts verhaftet. Gestorben am 16.August 1948 im Lager Sachsenhausen. Günter Radelhof hatte helle Haut, Sommersprossen, rote Haare und trug eine Brille. Eine Jugendfreundin von ihm sucht zur Aufklärung seines Schicksals ehemalige Mithäftlinge, die etwas über ihn berichten können«.
Keiner glaubte an einen Erfolg der Suchanzeige, denn 53 Jahre sind eine lange Zeit - aber ich wartete doch voller Spannung.
Nach wenigen Tagen klingelte mein Telefon. Ein Herr Kurt G. aus R. war am Apparat. Von diesem Ort R. hatte ich noch nie gehört und wußte gar nicht, daß es ihn überhaupt gibt. Herr G. sagte, er habe gerade den »Stacheldraht« gelesen und Günter auf dem Bild sofort erkannt. Er war lange Zeit mit ihm in der gleichen Baracke zusammen, aber von Günters Tod wisse er nichts. Er selbst war Ende August 1948 aus Sachsenhausen entlassen worden; man hatte ihn schon als Fünzehnjährigen von zu Hause weggeschleppt; da er aber in der letzten Zeit im Lager in der Schusterei arbeitete und in eine andere Unterkunft ziehen mußte, hatte er Günter aus den Augen verloren. Wie er mir nun Günter am Telefon beschrieb, war es Günter, wie er einmal leibte und lebte. Ja, er mußte den Günter, den ich suchte, wirklich gekannt haben. Er erzählte mir, Günter war immer zu Dußligkeiten bereit gewesen und das sei auch der Grund, warum er sich so gut an ihn erinnere.
Er schilderte mir gleich eine für Günter typische Begebenheit.
Günter fragte laut in der Baracke: »Kinder, soll ich euch mal was zeigen?« Und er nahm einen Bindfaden, in den er etliche Knoten gemacht hatte, hielt ein Ende fest und
atmete das andere Ende durch die Nase ein; dann ließ er es zum Mund heraushängen und zog es unter dem Gejohle und Staunen der Kameraden, auch noch hin und her.
Herr G. sagte, er konnte das gar nicht mit ansehen und schimpfte: »Menschenskind, laß doch diesen Blödsinn!«
Ja - es gab keinen Zweifel: Das war der Günter, dem ich nachspürte!
Das alles überraschte mich total und ich war sehr aufgeregt. Wir telefonierten lange und fanden einfach kein Ende.
Von nun an gab es des öfteren Gespräche mit Herrn G. und wir beschlossen, ein Treffen mit unseren Ehepartnern zu veranstalten. Da Herr G. vorschlug, daß wir ihn besuchen sollten, willigten wir ein. Günter verband uns auf rätselhafte Weise, wir sprachen miteinander wie uralte gute Bekannte - es gab kein fremdes Getue oder Verstellen.
Meinen Vorschlag, daß wir uns in einer Gaststätte treffen, lehnte Herr G. ab. Er lud uns zu sich nach Hause ein, weil er das gemütlich fand und so wünschte ich mir zum Mittagessen Erbseneintopf, weil Frau G. den gut vorkochen konnte.
Am 7.November 1997 fuhren wir also mit dem Auto von Berlin-Spandau nach R. in Sachsen-Anhalt.
Das war dann lustig: Ich hatte zu Herrn G. gesagt, gegen 11.00 Uhr werden wir bei Ihnen sein - und wirklich - eine Minute nach 11.00 Uhr hielten wir bei G. vor der Hoftür - und die ging auf und Gs. traten beide heraus, um nach uns Ausschau zu halten. Lachend fielen wir uns wie alte Freunde in die Arme. Das Erzählen wollte kein Ende nehmen. Zwischendurch stärkten wir uns mit der köstlichen Erbsensuppe und etwas später mit dem leckersten Kuchen, den man sich vorstellen kann.
Für Herrn G. schien es richtig eine Befreiung zu sein, so viel und so genau von dieser Zeit in Sachsenhausen erzählen zu können. Endlich konnte er ausführlich schildern, was geschehen war. Endlich hörte ihm jemand ganz genau zu. So viele Jahre in der DDR hatte er geschwiegen. Jetzt konnte er endlich sprechen - und ich war eine gespannte neugierige Zuhörerin.
Über eins waren wir uns einig: Trotz des Elends der Häftlinge, trotz der Kälte, trotz des grausamen Hungers, der erbärmlichen ungenügenden Bekleidung - trotz der Krankheiten und der Allgegenwärtigkeit des Todes, gab es heitere Begebenheiten, aus denen die Häftlinge Kraft und Leben sogen. Es gab auch Spaß, Witz, Galgenhumor vielleicht und Freundschaft.
Und einer, der oft für Heiterkeit in der Baracke sorgte, war Günter.
Sehr fiel wußte Herr G. nicht zu berichten - aber einiges doch. Günter lag ihm schräg gegenüber im mittleren Bett; drei waren immer übereinander. Stroh als Unterlage gab es nicht - sie hatten nur die kahlen Bretter und eine dünne Decke. Gemeinsam bastelten sich die Häftlinge der Baracke ein Schachspiel. Herr G. konnte sich nicht mehr erinnern, aus was sie die Figuren geformt hatten, aber höchstwahrscheinlich aus kostbarem, glitschigen Brot. Sie hockten stundenlang auf dem Gang zwischen den Betten und spielten. Herr G. sagte, und wenn er daran denkt, hat er immer Günter vor Augen, der mit vor der Brust verschränkten Armen an den Bettpfosten lehnte und über Stunden die Partie gespannt verfolgte.
Herr G. erzählte von Weihnachten 1945 und 1946. Fünf Jungen, darunter auch Günter, bildeten einen Chor und sangen für die Kameraden Weihnachtslieder; besonders gerne: »Hohe Nacht der klaren Sterne, die wie weite Brücken stehen.«
Es gab in Sachsenhausen eine Theatergruppe, die zu besonderen Anlässen vor den Mithäftlingen spielen durfte. An einem Tag für die Frauen - an einem anderen Tag für die Männer. An einem Frauentag sagte Günter: »Ach Menschenskind - ich habe gerade heute so eine Lust auf Theater. Ich verkleide mich und schmuggle mich in die Frauengruppe!« Unter dem ungläubigen Gelache der anderen, band er sich ein Kopftuch um und kämmte ein paar Haarstummelchen zum Pony. Er schlich sich wirklich in die Vorstellung - auf welche Art wußte keiner.
Später, als ich das der kleinen großen Frau erzählte, konnte sie sich sogar an diesen speziellen Fall erinnern, denn er hatte einiges Aufsehen erregt, weil Günter entdeckt worden war. Ein anderer Junge, der den gleichen glorreichen Einfall gehabt hatte, mußte mit ihm zusammen mehrere Tage in den Arrest - und der schmeckte bitter.
Günter, der Faxenmacher, pickte sich, um den anderen zu zeigen, was für ein kaltblütiger Kerl er war, eine Nadel durch die Backe und ließ sich bewundern.
Das alles, was Herr G. mir von Günter so anschaulich berichtete, bewies mir, daß der Günter aus Sachsenhausen, der Günter aus unserer Clique war, der mit uns und seinem Fahrrad so oft an der Ecke gestanden hatte, die heute noch von einer Telefonzelle geziert wird. Es tröstet mich, daß er sich auch in der finstersten Zeit seines kurzen Lebens etwas von seinem ureigensten Wesen bewahrt hatte.
Tschüss Günter!